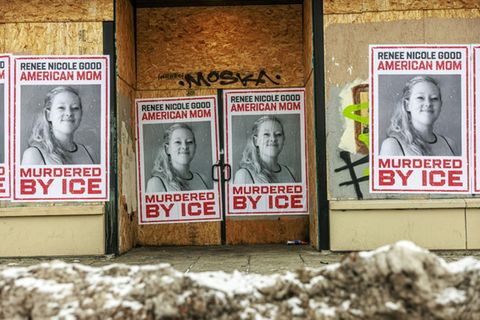Es begann mit Steinwürfen und Hartgummigeschossen und eskalierte im Laufe der Monate zu einem Konflikt, in dem Israelis und Palästinenser mit allen Sorten scharfer Waffen von Gewehren über Granatwerfer bis hin zu Panzern und Kampfhubschraubern aufeinander losgingen. Der bisherige Höhepunkt waren die israelischen Luftangriffe auf palästinensische Einrichtungen vom Wochenende. Damit aber wurde endgültig der fließende Übergang vom bewaffnetem Unfrieden zum Krieg vollzogen: Erstmals seit über einem Vierteljahrhundert droht dem Nahen Osten wieder ein Waffengang internationalen Ausmaßes.
Dabei war die waffentechnische Überlegenheit immer unangefochten auf Seiten Israels und dieses machte leider auch Gebrauch davon. Denn die Palästinenser verfügen über keine Luftwaffe, keine schweren Panzer oder Kampfhubschrauber. Sie griffen auf die einzige schreckliche Waffe zurück, die sie haben: Terroranschläge von Selbstmordattentätern, die im israelischen Hinterland meist unbeteiligte Zivilisten treffen. Aber nicht nur der Waffengebrauch eskalierte, sondern auch die Einstellung dazu. Als im März der alte Haudegen Ariel Scharon neuer Ministerpräsident Israels wurde, geriet die Gewalt in den palästinensischen Gebieten zunehmend außer Kontrolle.
Nach anfänglicher Zurückhaltung zeigte Scharon der Welt, dass er der Alte geblieben war und alles Gerede über seine
angebliche Wandlung dem Wunschdenken von Leuten entsprang, die hoffen wollten, dass es so schlimm schon nicht werden würde. Vom Friedensprozess, zu Jahresbeginn noch in aller Munde, redet heute kaum noch jemand. Dafür redet man zunehmend von einem bevorstehenden Krieg, ohne zu wissen, ob man nicht schon mittendrin ist.
Israelische Siedlungspolitik größtes Hindernis
Als größt es Hindernis für den Weg zurück zum Frieden entpuppt sich einmal mehr die israelische Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten und die Militanz der jüdischen Siedler selbst. Sie erweisen sich mit ihrem jüdisch-nationalistischen Fundamentalismus immer wieder als die besten Verbündeten der militanten Friedensgegner auf palästinensischer Seite, ohne dass man dahinter eine berechnende Absicht vermuten müsste.
Viele von ihnen, obwohl oftmals selbst erst vor weniger als einer Generation ins »gelobte Land« eingewandert, sehen in den alteingesessenen Palästinensern nichts anderes als Eindringlinge, die ihnen die »biblische Heimat« Erez Israel streitig machen wollen. Obwohl selbst viele Israelis ihnen mit Misstrauen bis hin zu offener Abneigung begegnen, glaubt seit langem keine Regierung in Jerusalem mehr, gegen sie regieren, geschweige denn, sie von ihrem nach internationalem Recht illegal besetzten Land vertreiben zu können.
Die Lage in Hebron ist ein beredtes Beispiel für die verhängnisvolle Rolle militanter Siedler im besetzten Gebiet. In der Großstadt leben knapp 500 Siedler mitten unter 130.000 Palästinensern. Um dieses jüdische »Dorf« nicht der
palästinensischen Selbstverwaltungsbehörde unterstellen zu müssen, behielt Israel die Herrschaft über ein Fünftel der Stadt. Damit sich 500 Siedler dort frei bewegen können, müssen die 30.000 Palästinenser, die in diesem Teil Hebrons leben, den größten Teil des Tages eine Ausgangssperre hinnehmen.
120 Soldaten zum Schutz für sieben Siedlerfamilien
Die Sicherheit der Siedler erfordert darüber hinaus eine unverhältnismäßige Truppenpräsenz. In ihrem Stützpunkt Tel Romeida hausen in Wohncontainern 120 Soldaten, die allein für den Schutz von sieben Siedlerfamilien verantwortlich sind. Einer ihrer Befehlshaber, Leutnant Tamir Milrad, fühlt sich in Hebron nicht recht wohl in seiner Haut. Der 22-Jährige ist in einem Kibbutz aufgewachsen, und in den liberalen und sekulären Kibbutzim stehen die als ultraorthodoxe Zeloten geltenden Siedler in keinem guten Ansehen. Er sehe zwar ein, dass er die Juden hier schützen müsse, habe aber kein gutes Gefühl dabei, einer alten Araberin erklären zu müssen, dass sie eine bestimmte Straße nicht benutzen dürfe, sagt Milrad.
Milrads Unbehagen ist aber nur ein schwacher Trost für die palästinensische Bevölkerung Hebrons. Sie fühlen sich von den Siedlern drangsaliert und beschuldigen die israelischen Soldaten, nichts zu ihrem Schutz zu unternehmen. So benehmen sich viele Siedler wie Besatzer, laufen schwer bewaffnet auf den Märkten umher und stoßen die Araber rücksichtslos zur Seite, wenn sie ihnen im Weg stehen. Noch immer haben die Palästinenser von Hebron nicht vergessen, dass einer der Siedler 1994 29 gläubige Moslems ohne den geringsten Anlass beim Beten in der Moschee erschoss. Seitdem ist die Atmosphäre hier vergiftet, vergiftet wie an vielen Orten, in denen Israelis und Palästinenser nebeneinander leben.
Yoav Appel, AP