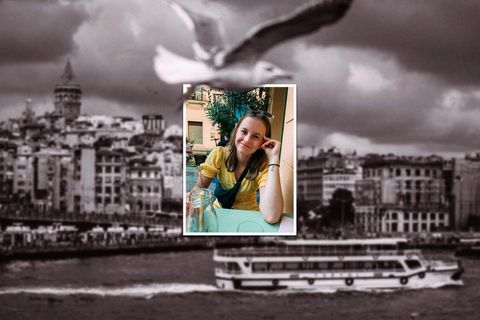Die türkische Regierungspartei AKP wird nicht verboten. Im Verfassungsgericht in Ankara kam nicht die erforderliche Mehrheit zustande, wie der Gerichtsvorsitzende Hasim Kilic nach den dreitätigen Beratungen mitteilte. Zwar hätten sechs von elf Richtern ein Verbot befürwortet, nach den Gerichtsvorschriften wären jedoch sieben Stimmen erforderlich gewesen.
"Ernsthafte Warnung"
"Die Entscheidung ist eine Warnung, eine ernsthafte Warnung", erklärte Kilic. Dies wurde auch deutlich an dem Gerichtsbeschluss, der islamisch ausgerichteten Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) die Hälfte der staatlichen Förderung zu entziehen. Gleichwohl bedeutete die Entscheidung einen Sieg für Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan in seiner monatelangen Auseinandersetzung mit der säkular orientierten Staatsanwaltschaft.
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier reagierte erleichtert. Jetzt komme es darauf an, dass alle Entscheidungsträger ihren Beitrag zu Versöhnung und politischer Stabilität im Land leisteten und am Reformkurs entschlossen festhielten, erklärte der SPD-Politiker. Für die weitere Annäherung der Türkei an die Europäische Union sei es nun wichtig, dass die Türkei ihre demokratischen Institutionen im Rahmen der Verfassungsreform weiter stärke. Außerdem müsse das Parteiengesetz mit europäischen Standards in Einklang gebracht werden.
Streit um Kopftuch
Die türkische Staatsanwaltschaft hatte ihren Verbotsantrag im März eingebracht und neben dem Parteiverbot ein fünfjähriges Verbot der politischen Betätigung für Erdogan und 70 weitere AKP-Mitglieder beantragt, darunter auch Staatspräsident Abdullah Gül. Chefankläger Abdurrahman Yalcinkaya warf der Partei Erdogans vor, sie wolle in der Türkei das islamische Recht einführen. Die Staatsanwaltschaft hatte sich in ihrer Anklage in erster Linie auf Äußerungen Erdogans berufen. Der Regierungschef hatte gefordert, das Kopftuch als religiöses und politisches Symbol in den Hochschulen zuzulassen. Im Februar 2008 hatte das Parlament auf Initiative der AKP per Verfassungsänderung eine Freigabe des Kopftuches für Studentinnen durchgesetzt. Die Änderung wurde vier Monate später vom Verfassungsgericht kassiert. Damit sind Frauen, die Kopftücher tragen, weiterhin von einem Hochschulstudium ausgeschlossen.
Die AKP hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen und auf Reformen verwiesen, die die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union ermöglichten. Das Gerichtsverfahren war der vorläufige Höhepunkt in dem Konflikt zwischen den dominierenden säkularen Kräften in Justiz und Militär einerseits und der AKP andererseits. Deren Mitglieder sind stark religiös geprägt und unterhalten zum Teil Verbindungen zur islamistischen Bewegung der Türkei. Ein Verbot der Partei hätte weitreichende politische Konsequenzen gehabt und das Land in eine schwere Krise gestürzt. Die EU hat die AKP als demokratisch legitimierte Partei bezeichnet, die gegebenenfalls an der Wahlurne, nicht aber im Gerichtssaal diskreditiert werden sollte.
Die Beratungen der Richter begannen einen Tag, nachdem zwei Bombenanschläge in Istanbul 17 Menschen in den Tod gerissen hatten. Ein etwaiger Zusammenhang konnte vorerst allerdings nicht nachgewiesen werden. Umstritten ist in der Türkei auch ein von der AKP angestrengtes Gerichtsverfahren gegen 86 Personen, denen Umsturzpläne vorgeworfen werden. Darunter befinden sich mindestens ein früherer General sowie Journalisten, Akademiker und Geschäftsleute.