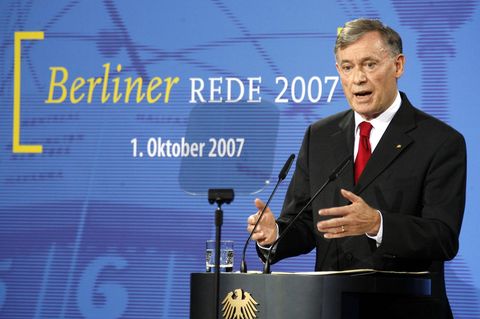Alle rätselten jahrelang: Warum trat Horst Köhler als Bundespräsident zurück? Eine Antwort versucht das Buch eines ARD-Journalisten aus dem Jahr 2013.
Buch "Machtmaschine" Warum Horst Köhler zurücktrat
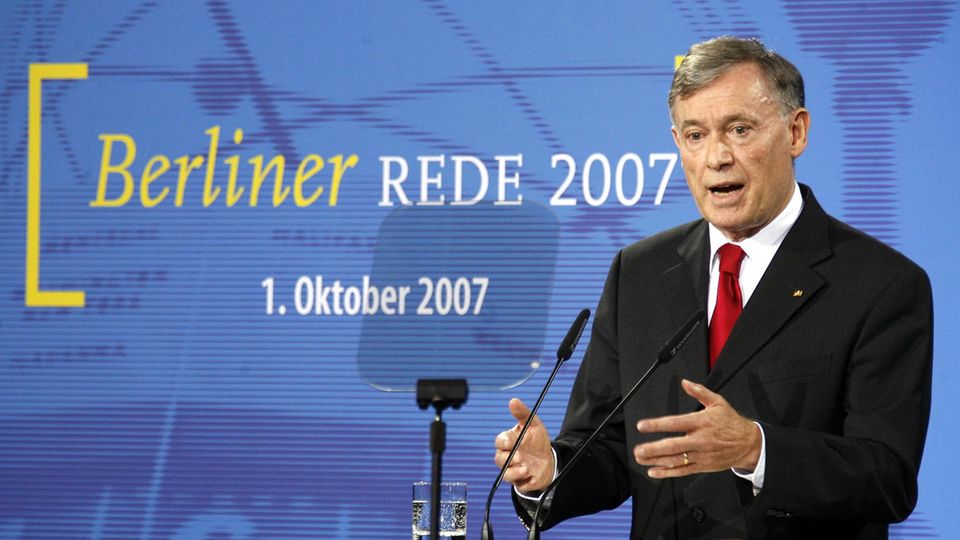
© Wolfgang Kumm/
Sehen Sie im Video: Die politische Karriere von Horst Köhler in bewegten Bildern.
n-tv.de