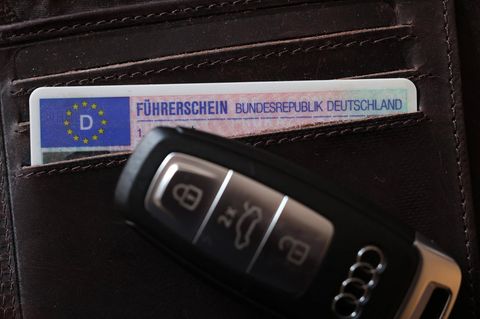Es war ein glänzender Abschied - bis zum Jahr 2021. Frühestens dann wird wieder ein deutscher Bundeskanzler als EU-Ratspräsident die Geschicke der Europäischen Union maßgeblich mitbestimmen können. Nach sechs Monaten an der Spitze der EU wurde Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Europaparlament in Brüssel mit Lob von allen Seiten geradezu überschüttet. Gut, groß oder gar unvergesslich: Die Volksvertreter befanden in seltener Einmütigkeit, dass die Deutschen in der Führung des Ministerrates ungewöhnlich erfolgreich waren.
Der Ausweg aus der schweren Verfassungskrise ist das bleibende Verdienst der Kanzlerin. Mit der in der EU stets gefragten Mischung aus Standhaftigkeit und Flexibilität schaffte Merkel bei einer 20-stündigen Nonstop-Gipfelsitzung die Quadratur des Kreises. Die "Substanz" der Verfassung wird erhalten, aber eine Verfassung ist der neue Grundlagenvertrag nicht mehr. Auch im Europaparlament herrschte weitgehend Einigkeit: Schön ist das Mandat für die Vertragsänderungen nicht, doch es ging nicht anders. Merkel bemühte ein afrikanisches Sprichwort zur Erläuterung ihrer Arbeit: "Wenn Du schnell gehen willst, dann geh alleine. Wenn Du weit kommen willst, dann geh zusammen."
EU will mit einer Stimme sprechen
Werden die neuen Verträge nicht nur von den Regierungen unterzeichnet, sondern auch ratifiziert, so wird in der EU öfter mit Mehrheit entschieden, außenpolitisch will die EU mit einer Stimme sprechen, das Parlament bekommt mehr Rechte - und die EU kann neue Mitglieder aufnehmen, was ihr durch den noch geltenden Vertrag von Nizza untersagt ist. Vor allem gelang es gegen den erbitterten Widerstand Polens, die "doppelte Mehrheit" (55 Prozent der Staaten und 65 Prozent der Bevölkerung) zu beschließen, die spätestens ab 2017 die Blockademöglichkeiten einzelner Staaten verringern und damit die EU handlungsfähiger machen sollen.
Mit der Drohung, diese Regelung auch gegen den Willen des polnischen Führungsduos Lech (Präsident) und Jaroslaw (Regierungschef) Kaczynski bei der Regierungskonferenz in Auftrag zu geben, legte Merkel zu nächtlicher Stunde die Folterwerkzeuge der Ratspräsidentschaft auf den Brüsseler Verhandlungstisch. "Kaltblütig und erfolgreich", so ein Diplomat anerkennend, habe sie beim EU-Poker mitgemischt. "Den Machos wie Blair, nicht nur den Zwillingen" sei sie mutig entgegengetreten, lobte der grüne Alt-Revoluzzer Daniel Cohn-Bendit die Kanzlerin gut gelaunt im Hohen Haus.
Nachbarschaftspolitik bekommt Gesicht
Selbst wenn das Meisterstück EU-Grundlagenverträge nicht gelungen wäre, so hätte sich die Bilanz der deutschen Präsidentschaft - deren tägliche und meist weniger glanzvolle Hauptlast vor allem der unermüdliche Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) trug - noch sehen lassen können. Mit den beim März-Gipfel in Brüssel beschlossenen Klimazielen gab die EU weltweit ein Zeichen für die Reduzierung der Treibhausgase. Die Verhandlungen über einen Türkei-Beitritt wurden vorangetrieben, wenn auch wegen französischen Einspruchs nicht so stark wie eigentlich geplant. Die Nachbarschaftspolitik beispielsweise mit Staaten des Kaukasus bekam Gesicht, die Wiederbelebung des Nahost-Quartetts ist ganz besonders ein Erfolg Steinmeiers.
Mit Beharrlichkeit wurden unter deutscher Präsidentschaft wichtige Vorhaben wesentlich vorangebracht: Von der Begrenzung der Roaming- Gebühren über eine engere Vernetzung von Strafregistern und Justizdaten bis hin zur Schaffung eines Europäischen Technologie-Instituts reichen die keineswegs leicht erzielten Erfolge. Doch auch Schatten bleiben: Die Beziehungen zwischen der EU und Russland konnten nicht neu ausgehandelt werden. Polen hielt an seinem Veto fest, weil Moskau nach wie vor kein Fleisch aus Polen ins Land lässt. Nun sollen es die Portugiesen richten. Für den EU-Russland-Gipfel am 26. Oktober in Lissabon tickt bereits die Uhr.