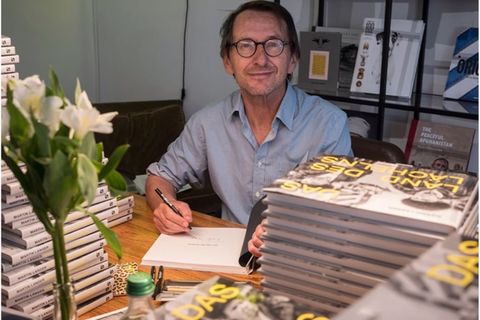Das atomare Zwischenlager in Gorleben wurde 1983 nach knapp zweijähriger Bauzeit fertig gestellt. Zunächst wurde das so genannte Transportbehälterlager (TBL) für die Einlagerung von 1500 Tonnen abgebrannter Brennelemente aus deutschen Atomkraftwerken genehmigt. Im Juni 1995 wurde die Genehmigung auf eine Menge von 3800 Tonnen Brennstoff erweitert. Zudem dürfen seitdem auch Glaskokillen aus der Wiederaufarbeitung in das Zwischenlager gebracht werden. Die Genehmigung des Lagers ist bis zum 31. Dezember 2034 befristet.
Kernstück der von der Brennelementlager Gorleben GmbH (BLG) betriebenen Anlage ist eine 182 Meter lange, 38 Meter breite und 20 Meter hohe Halle. Sie wurde aus Stahlbeton mit einem Betonplattendach errichtet. Die Außenwände sind mit Aluminiumblechen verkleidet. Große Zu- und Abluftöffnungen bewirken, dass die Abwärme der eingelagerten Behälter durch den natürlichen Zug nach außen geleitet wird.
Erste Castor-Transporte wurden 1995 ins Zwischenlager gebracht
Langwierige Prozesse sowie atomrechtliche Auseinandersetzungen zwischen dem Bund und dem Land Niedersachsen führten dazu, dass der erste Castor-Behälter mit Atommüll erst 1995 in das Zwischenlager gebracht wurde. In der Halle gibt es maximal 420 Stellplätze. Die Betreiber der Atomkraftwerke bezahlen je Stellplatz - ob genutzt oder leer - rund 50 000 Mark im Jahr.
Atomkraftgegner haben schon vor den Terroranschlägen in den USA die Sicherheit des Lagers bezweifelt. Tatsächlich bietet die Halle keinen Schutz gegen Flugzeugabstürze. Die Betreiber weisen darauf hin, dass die Halle keine besondere Sicherheitsfunktion habe, sondern nur ein Wetterschutz sei - der Schutz des strahlenden Mülls werde schließlich durch die Castor-Behälter gewährleistet.