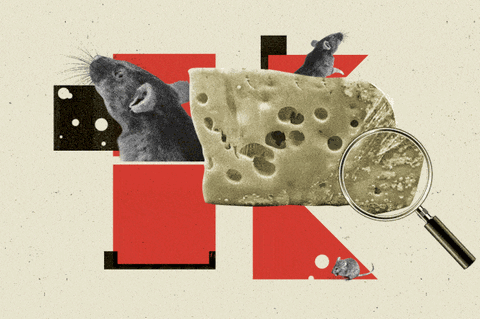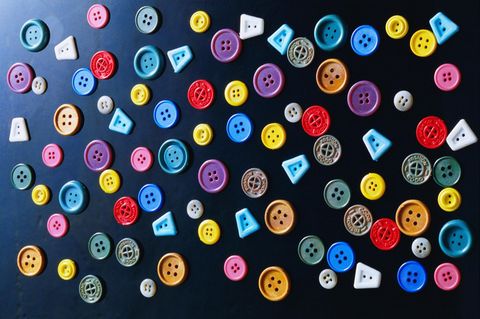Zuerst Ekel, dann Mitleid empfand der Dichter Heinrich Heine, als er "den Zustand dieser Menschen näher betrachtete und die schweinestallartigen Löcher sah, worin sie wohnen, mauschelen, beten, schacheren und - elend sind". Doch so elend es dort auch sein mochte, das Schtetl - die jüdische Siedlung oder das jüdische Viertel einer Kleinstadt - war für die Bewohner eine heile Welt. Hier gab es eine Synagoge, einen Friedhof und eine Mikwe, das rituelle Badehaus. Alles im Schtetl war jüdisch, die Kleidung, die Sprache, die Sitten. Da die russischen Gesetze im ausgehenden 19. Jahrhundert den Juden nur begrenzt erlaubten zu arbeiten, streiften viele von ihnen Tag für Tag umher, auf der Suche nach Beschäftigung. Die wenigsten verließen je ihr Viertel. Sie führten ihr Leben - und blieben unter sich.
Die Gemeinden, zu denen Nichtjuden keinen Zugang hatten, wurden zu Fremdkörpern im Land - misstrauisch beäugt von den Russen, die selbst in elenden Verhältnissen lebten. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entlud sich dieses Misstrauen in Hass und Barbarei.
Provokationen an einem Festtag
Zum Beispiel in Kischinew. Der 6. April 1903 war ein Festtag. Die russisch-orthodoxen Christen feierten Ostersonntag, die jüdische Gemeinde den letzten Tag des Passahfestes. Es war bereits ungewöhnlich warm. Um den Chuflinskij-Platz waren Buden und Karussells aufgebaut. Der Alkohol floss wieder - nach der langen Zeit des Fastens. Bereits am frühen Nachmittag waren die ersten Christen betrunken. Während die Kinder auf dem Karussell ihre Runden drehten, fingen die Jugendlichen an, Kreise um einzelne Juden zu bilden, grölend und drohend, bis diese ausbrachen und flohen. Mehr und mehr Erwachsene stießen zu der Meute. Als kein Jude mehr in Sicht war, brach man auf, sich neue zu suchen.
Kleine Gruppen von 10 bis 15 Männern zogen Richtung Judenviertel. An der Spitze die Hetzer, die mit ausgestreckten Fingern auf Wohnhäuser und Geschäfte zeigten, die Steinewerfer sich dann vornahmen. Im Schlepptau Mitläufer, die plünderten, was hinter den zerbrochenen Schaufenstern und aus den Angeln gerissenen Haustüren zu holen war. Ein paar Polizisten, die mit den Randalierern reden wollten, wurden beiseite gedrängt.
Am späten Abend löste sich der Mob auf. Doch am nächsten Morgen drängten die Ersten erneut ins jüdische Viertel. Wenn sie ein Kleidungsgeschäft stürmten, probierten Männer und Frauen noch auf der Straße Hosen und Röcke an. Brachen sie in eine Weinhandlung ein, setzten sie die Flaschen gleich an den Hals. Die Gassen waren bald übersät von Scherben, überall wirbelten die Federn aufgeschlitzter Bettdecken. Fand man einen Juden, wurde er aus seinem Versteck gezerrt und niedergeschlagen. Die Bilanz des Osterfestes in Kischinew: 49 tote Juden, 500 Verletzte, 700 zerstörte und geplünderte Wohnhäuser, 600 verwüstete Geschäfte. 2000 jüdische Familien wurden obdachlos.
Pioniere des Zionismus
Nicht jedes Pogrom ist so gut dokumentiert wie das von Kischinew. Nicht von jedem Schtetl gibt es Listen mit den Namen der Toten, der zerstörten Existenzen. Zwischen 1881 und 1914 flohen rund 2,5 Millionen osteuropäische Juden aus ihrer Heimat. 80 bis 85 Prozent von ihnen wanderten nach Amerika aus. Einige zogen in das Land ihrer Vorväter, nach Erez Israel. Sie wurden die ersten Pioniere des Zionismus.