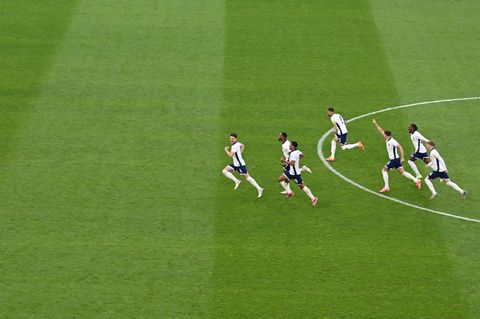Berlin, WM-Viertelfinale 2006. Deutschland gegen Argentinien. Nach 120 Minuten steht es 1:1. Die Entscheidung muss im Elfmeterschießen fallen. Jens Lehmann scheint gut vorbereitet. Er hält einen Spickzettel in den Händen auf dem sieben mögliche Schützen Argentiniens und ihre Platzierungsvorlieben verzeichnet sind. "Ayala 2 lange warten, langer Anl. Rechts, Rodríguez 18 links." Lehmann hat gut gehalten und Deutschland ins Halbfinale gehechtet, aber der Zettel hat dazu nur wenig beigetragen. Lediglich zwei der verzeichneten sieben haben tatsächlich geschossen und nur einen ihrer Schüsse hat Lehmann gehalten.
Kann man vorhersehen, wie ein Fußballer einen Elfmeter umwandelt? Und was hilft es, sich die Elfmeterschützen anzusehen und ihre Vorlieben zu notieren? Soziologen aus Leipzig sind diesen Fragen nun nachgegangen. Sie sagen, ein professioneller Elfmeterschütze ist nicht berechenbar oder soziologisch ausgedrückt: Er verfolgt kein Muster.
Was Exceltabellen über Thomas Hässler verraten
Über 1000 Elfmeter der Bundesligasaisons 1993/94 bis 2003/04 haben Roger Berger und sein Student Rupert Hammer untersucht, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Dazu haben sie nicht wochenlang Videos ausgewertet, sondern sich nüchterne Zahlenkolonnen in Excelform angeschaut. Die Statistiken, in denen genau verzeichnet ist, wer wann wohin geschossen hat, gab es von einer Münchener Firma, die auch die Bundesligavereine mit Informationen versorgt. Daraus haben sich die Wissenschaftler 13 Torhüter und 12 Schützen, die bei mehr als 20 Elfmetersituationen beteiligt waren, ausgesucht. Darunter sind Oliver Kahn, Jörg Butt und Jens Lehmann und auf der Schützenseite Thomas Hässler, Toni Polster und Ailton.
Die Idee, das Elfmeterverhältnis zu untersuchen, ist nicht neu. Auch die Amerikaner haben vergleichbare Untersuchungen angestellt. "Allerdings haben wir die besseren Daten. Denn unsere Aussagen beziehen sich auf einen längeren Untersuchungszeitraum", erklärt Roger Berger, der das theoretische Know-how der Arbeit lieferte.
Labor gegen Spielfeld
Im Grunde geht es darum, Spieltheorien zu überprüfen. Also Strategien bei so genannten "Nullsummenspielen", in denen einer gewinnt, weil der andere verliert. Nichts anderes ist das Elfmeterschießen. Derartige Tests finden normalerweise in einer Laborumgebung statt. Hierbei werden die Probanden gebeten, sich ganz zufällig zu verhalten, so wie ein Elfmeterschütze, der nicht will, dass sein Schussverhalten berechenbar ist. "Das bewirkt allerdings in der Regel das Gegenteil, denn Menschen tendieren in solchen Situationen dazu, gerade deshalb Musterverhalten auszubilden", sagt Berger. Beim Münzenspiel, "Kopf oder Zahl", zum Beispiel, wechselten Menschen sehr häufig ihre Ansage, wenn zweimal das gleiche kommt und bildeten somit ein bestimmtes Muster aus.
Berger und Hammer wollten nun wissen, ob sich in realen Spielsituationen wie dem Elfmeterschießen ähnliche Muster zeigten, also ob zum Beispiel ein ständiges Wechseln der Schussstrategie zu beobachten ist. Dabei haben die beiden Leipziger Soziologen Erstaunliches festgestellt: Nur bei zwei von zwölf Spielern war ein Muster erkennbar. So schoss Michael Zorc, langjähriger Mittelfeldspieler bei Borussia Dortmund, bei 20 Elfmetern abwechselnd neun Mal in die linke und elf Mal in die rechte Ecke. Bei zehn Spielern ließ sich hingegen kein Muster feststellen, resümieren die Wissenschaftler. Elfmeterschießen ist also Glückssache, denn Profispieler verhalten sich soziologisch optimal, also unvorhersehbar. Das sieht bei Tennisspielern ganz anders aus. "Dort konnte man feststellen, dass das Spielverhalten weit weniger zufällig ist als bei Elfmeterschützen", so Berger.
Kahn war kein Elfmeterkiller
Manchmal zeigt sich tatsächlich eine Tendenz: Wer mit dem rechten Bein schießt, trifft nach links etwas besser, was den Tormann veranlasst, eher dorthin zu springen als in die andere Ecke. Viele andere medial verbreitete Vorteilsklischees konnten die Leipziger jedoch nicht bestätigen. "Ob ein Elfmeterschütze trifft, hat weder mit einem Heimvorteil zu tun, noch ist es einfacher zu schießen, wenn man in Führung liegt." Auch spielt der Zeitfaktor keine Rolle. Es ist also egal, ob man kurz vor Schluss oder mitten im Match an den Elfmeterpunkt treten muss. Auch die "Fußballwahrheit", dass der Gefoulte nicht selber schießen sollte, kann vielleicht auf dem Beckmannschen Kommentatorenzettel stehen, ist aber statistisch nicht belegbar.
Die oft verbreitete Meinung, dass Oliver Kahn der so genannte "Elfmeterkiller" gewesen sei, haben die Soziologen ebenfalls statistisch widerlegt. "Der beste Tormann war Claus Reitmaier, der einst beim VfB Wolfsburg zwischen den Pfosten stand", sagt Berger.
Allerdings wurde bei einer anderen Untersuchung von deutschen und italienischen Pokalspielen festgestellt, "dass, wenn eine Mannschaft aus einer unteren Liga gegen einen Bundesligisten im Elfmeterschießen steht, der Underdog einen Heimvorteil hat".
Elfmeterschießen bleibt spannend
Wenn schon die Information des berühmten Zettels von Jens Lehmann nicht spielentscheidend war, so glaubt Berger, könnte vielleicht der psychologische Effekt des Papiers eine Rolle gespielt haben. "Dass Lehmann da etwas in den Händen hielt von dem man nicht wusste, was es ist, kann den einen oder anderen argentinischen Spieler verunsichert haben", sagt Berger. Aber psychologische Tricks sind von kurzer Halbwertszeit, denn der Gegner kann sich darauf einrichten und entsprechend reagieren. So hampelte Jerzy Dudek, ehemaliger Torwart des FC Liverpool, bei Elfmetern immer auf der Linie herum - ein Gag, der sich nicht durchgesetzt hat. "Auch als Jugendliche haben wir versucht den Tormann zu narren, indem man in die eine Ecke schaute und dann in die andere Ecke schoss", erinnert sich Berger. Vielleicht funktioniere so ein Trick einmal, aber nie langfristig.
Eigentlich ganz erfreulich, dass der Fußball durch die Wissenschaft nicht der Spannung beraubt werden kann.