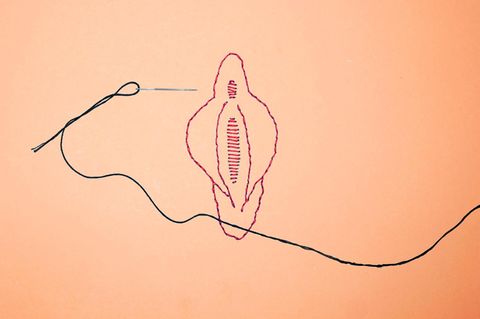Nein, über die Machenschaften beim Geschäft mit dem Victoriabarsch wird John erst später reden, über das Kartell des illegalen Fischfangs, die Marktmacht der Ausländer. Jetzt hockt John Kayumba auf dem grün getünchten Boot Nummer 409 an der Anlegestelle und hat zu tun. Morgengrauen in Kasensero, die Fischer kommen zurück. Übers Handy bekommt der 49-Jährige die Prognose für den Victoriabarsch-Tagespreis: 6000 Schilling pro Kilo, umgerechnet 1,50 Euro. Nicht schlecht. Die Inder, Betreiber der Verarbeitungsfabriken, drücken den Preis schon mal auf 4000. Das macht einen Unterschied.
John hat 34 Boote da draußen.
Das Fischerdorf Kasensero im Süden Ugandas schmiegt sich an einen Hügel am Victoriasee. Hunderte Holzboote mit Außenbordern tuckern zur Anlegestelle. Je zwei kantige Kerle bilden die Crews, manche haben noch einen Turnboy dabei, einen Helfer. Die guten Fanggebiete sind weit draußen, 30 Liter Sprit kalkulieren sie pro Tour. Die ganze Nacht auf rauer See, alle sind geschafft. Unter Kommandos von Taktgebern, „rrrrumm-heiheihei“, schieben Netzmacher die schweren Holzboote Zentimeter für Zentimeter auf den Sand. „Ey, Weißer, mithelfen!“, ruft einer, und die Männer feixen.
Um acht liegt eine Flotte von 400 Booten dicht gedrängt an der Landestelle. Der Fang wird an Handwaagen gehängt. Als groß gelten Victoriabarsche mit 15 bis 20 Kilo; in den Achtzigern waren sie im Schnitt noch 50 Kilo schwer. Mittelsmänner bieten zuerst für die großen, Geldscheine wechseln Hände. Die Leute am Waschplatz tragen weiße Gummistiefel. Nebenan warten ein Dutzend Kühllaster, auf der Ladefläche eisen Arbeiter den Fisch ein.
Bessere Zeiten für die Fischer
Die Fabriken in Kampala und Jinja lassen Laster nur vollgepackt losfahren. Bei gutem Fang dauert das zwei Tage, in Krisenzeiten auch länger. In Uganda haben zwölf Fabriken zur Weiterverarbeitung von Victoriabarsch Exportlizenzen für Europa. Dort landen 80 Prozent der weißen Filets aus dem Victoriasee. Im Fischgeschäft in Hamburg kostet ein Kilo 14 Euro.
John Kayumba fuhr als junger Mann selbst hinaus in die Nacht, er kennt den See, seine Kraft, seine Schwächen, das ganze ökonomische, soziale, ökologische Auf und Ab an den Küsten. „Für uns brechen wieder bessere Zeiten an“, sagt er, als sich der Morgentrubel langsam legt. „Jetzt ist wieder mehr Fisch im Victoriasee, und er ist größer.“ Seine Leute brachten sogar einen Kracher von 140 Kilo mit.
Dabei herrschte bis vor drei Jahren noch Endzeitstimmung in Kasensero. Der See war fast leer gefischt worden mit engmaschigen Netzen, in denen sich Jungfische verfingen, bevor sie Eier legen konnten. Dem Barsch drohte das Aussterben. John hatte keine zehn Boote mehr draußen.
Der Victoriabarsch und der Victoriasee, das ist eine Geschichte dramatischer Wendungen. Der See ist mit 68.800 Quadratkilometer Oberfläche etwa so groß wie Bayern und 128-mal so groß wie der Bodensee. Er dient 200.000 Fischern als Lebensgrundlage, versorgt mehr als 30 Millionen Afrikaner in drei Anrainerstaaten, Tansania, Uganda, Kenia.
Aus dem nördlichen Teil fließt bei Jinja der Nil ab Richtung Mittelmeer. Unter britischer Kolonialhoheit setzten Wissenschaftler hier vor 60 Jahren die bis dato nur im Fluss verbreiteten Nilbarsche aus, um eine kommerzielle Fischindustrie zu schaffen. Seitdem heißt er Victoriabarsch. Zwei Jahrzehnte später war er die dominante Art. Ohne natürliche Fressfeinde hatte er Hunderte einheimische Arten ausgelöscht, darunter die meisten Algenfresser. Die Sauerstoffkonzentration im Wasser sank, die Verschmutzung stieg, es war eine ökologische Katastrophe. Der Dokumentarfilm „Darwins Alptraum“ zeigte 2004 das Geschäft mit dem Victoriabarsch als finsterste Globalisierung.
Lebensgefährliches Geschäft
Investoren galt der Raubfisch dagegen als weißes Gold. Zahllose Landarbeiter zogen in die Fischergemeinden am See, um vom Barschboom zu profitieren. 60.000 Boote balgten sich um den Fang im See, darunter zusammengezimmerte Barken. Nach Angaben des Internationalen Roten Kreuzes sterben bis heute jedes Jahr bei den Stürmen im See 3000 bis 5000 Fischer, mehr als Migranten auf dem Weg nach Europa im Mittelmeer.
Binnen kurzer Zeit schrumpfte die Barsch-Population um die Hälfte. Legale Exporte gingen um ein Drittel zurück. 95 Prozent der Barsche im Victoriasee waren kleiner als die vorgeschriebene Fanggröße von 50 Zentimetern. Der Schwarzmarkt mit Jungfisch boomte. Korrupte Beamte bei Fischereibehörden und Marinepolizei hielten die Hand auf und sahen weg. Verarbeitungsbetriebe mussten schließen, Tausende Frauen verloren ihre Jobs. Die Fischerboote kamen oft leer zurück an den Anleger von Kasensero.
John Kayumba war Chef der „Beach Management Unit“ im Ort, der gewählte Vertreter der Fischer. Es war nicht leicht, gegen das Abfischen von Jungbarschen vorzugehen. Fast jeder machte mit, auch Nachbarn und alte Bekannte. Vom ärmsten Netzmacher bis zum Aufsichtsbeamten im Distrikt, für alle war der Victoriabarsch ein Geldfisch. Viele begriffen nicht, dass sie ihre eigene Existenzgrundlage zerstörten.
John und seine Leute verhafteten Fischer und Schmuggler mit illegalem Fanggerät, übergaben Hintermänner der Polizei – „und am nächsten Tagen waren sie wieder frei“. Er selbst wurde Ziel von Angriffen, man zerrte ihn als Holzschmuggler vor Gericht: „Noch heute sitzen die Organisatoren der illegalen Fischerei im Parlament und in den Ministerien. Der Victoriasee ist ihnen völlig schnuppe.“
Korruption und Militärgewalt
Präsident Museveni entschloss sich zu einem drastischen Schritt. Anfang 2017 beorderte er die Armee damit, aufzuräumen mit dem Chaos im See. Die „Beach Management Units“ an den Anlegestellen wurden aufgelöst, korrupte Verwaltungsangestellte gefeuert. Soldaten patrouillieren noch heute den See. Die „Einheiten für Fischereischutz“ gingen zunächst brutal vor. Ertappte Fischer mussten unter vorgehaltener Waffe lebendigen Wildfang essen. Boote wurden angezündet, Hütten, in denen verbotene Netze lagen, verbrannt. Es gab Todesfälle, die nie aufgeklärt wurden. Offiziere schafften sich einen eigenen Schwarzmarkt für konfiszierten Fisch und beschlagnahmte Außenbordmotoren. Vorm Parlament verweigerte die Armee jegliche Stellungnahme.
Gegen diese Eingriffe in ihr Geschäft begehrten die Fischergemeinden auf. Sprachrohr war dabei die „Vereinigung der Fischer und Seenutzer Ugandas“. Sie ging klug vor. „Wir arbeiteten mit der Armee zusammen“, sagt Philemon Kudera, Vertreter der Organisation in Jinja. „Wir kennen uns aus, wir beobachten an den Landestellen jede Bewegung bei Deals mit Jungfischen und melden die Täter. Und wir zeigen Offiziere an, wenn wir von Gesetzesverstößen Wind bekommen.“ Geoffrey, ein Freund von Philemon, Fischer und Ex-Soldat, leitete so ein Spitzelteam. Er bezahlte dafür mit dem Leben. Aus Rache war ein Vertrauter von ihm angeheuert worden, der ihm in der Bar Gift in den Drink geschüttet hatte.
Zurück in Kasensero, bei John Kayumba. Der Name seiner Firma prangt auf seinen Booten, „Besiga Mukama“: Die an Gott glauben. Er schützt sich unter einem dicken Hoodie mit dem Aufdruck „Lucky“ vor dem Regen. „Mit den Soldaten kommt langsam der Fisch zurück“, sagt er. Bestandsproben von Wissenschaftlern lassen vermuten, dass die Population schon nach zwölf Monaten Armee-Einsatz um 30 Prozent gestiegen war.
Es gelten Vorschriften für Bootsgrößen, Netzmaschen. Jedes Schiff braucht ein Nummernschild. John benötigt eine Steuernummer, muss Kaufdokumente für ordentliches Fanggerät vorweisen. Seine Crews brauchen Fanglizenzen. Legale Boote kosten mindestens 1000 Euro, Außenborder 2000. Die Regularien erfüllen kann nur, wer Kapital hat. Fischer, die früher auf eigene Rechnung hinausfuhren, heuern heute bei Bootseignern an.
Drei Viertel der Prostituierten sind HIV-positiv
Trotzdem verdienen sie vergleichsweise gut in einem Land, das die Vereinten Nationen im Entwicklungsindex auf Platz 162 von 189 Nationen einstufen. Fast die Hälfte der Menschen am Ufer des Sees muss mit etwas mehr als einem Euro pro Tag auskommen. Fischer haben oft das Vierfache in der Tasche. Und Kasensero hat die Infrastruktur, damit diese jungen Typen das Geld schnell wieder ausgeben.
Sex für Fisch. Nur ein paar Schritte sind es von der Landestelle zu den 80 Bars und den 40 Hotels in den Gassen des Ortes. Graue Steinhäuschen mit Wellblechdächern, jeweils mit einem Zimmer. Kabelgewirr, Satellitenantennen. Tagsüber hängen Frauen die Wäsche raus, enge Tops, pinkfarbene Minis. Eine schlurft mit Baby durch die Gasse, Lockenwickler im Haar.
Stella Mamubero ist seit acht Jahren im Geschäft. Sie trägt vier silberfarbene Clips am rechten Ohr und ist Vorsitzende der Prostituierten-Vereinigung. Ihr Zimmer ist sechs Quadratmeter groß, ein Drittel der Fläche nimmt das Bett ein, unterm Tisch steht eine Nähmaschine. „Mädchen rufen mich von überall an und fragen, ob sie nach Kasensero kommen sollen. Wenn Fisch da ist und das Geschäft läuft, spricht nichts dagegen.“ Die Preise für Sex beginnen bei 5000 Schilling, umgerechnet 1,20 Euro. Meist kostet es das Doppelte. Stella schätzt die Zahl der Prostituierten in Kasensero auf „mindestens 400“. Den Frauen rät sie, sich auf keinen Fall auf „live Sex“, also Geschlechtsverkehr ohne Kondom, einzulassen, selbst dann nicht, wenn die Fischer viel Geld bieten.
Kasensero hat 15.000 Einwohner. Der Ort machte weltweit Schlagzeilen, weil hier in den frühen 1980er Jahren Aids erstmals als Epidemie erkannt wurde. Die HIV-Infektionsrate ist mit über 40 Prozent doppelt so hoch wie sonst am Victoriasee. Drei Viertel der Prostituierten sind positiv. Mit dieser Tatsache geht man dort verblüffend nonchalant um. Seit kostenlos Medikamente ausgegeben werden, bedeutet das Virus kein Todesurteil mehr. „Und diesen Fischertypen ist sowieso alles egal“, sagt Stella, „die sagen, im Wasser könnten sie jederzeit sterben.“ Schon nachmittags ab vier plärrt Musik aus den Bars im Viertel der Sexarbeiterinnen.
„Ein verrückter Ort, nicht wahr?“, sagt John Kayumba. „Ungefähr so verrückt wie das Geschäft mit dem Barsch. Armut ist eben ungerecht.“ John selbst hat sich mit dem System arrangiert. „Unser bester Fisch geht nach Europa, die Filets landen bei euch auf dem Teller, Gräten bleiben in Afrika, das ist das Setting. Aber wir in Uganda haben auch was davon.“ Vor 30 Jahren kam er als Kriegswaise nach Kasensero. „Der See hat mich vermögend gemacht. Ich konnte meine Kinder zur Schule schicken und die meiner Brüder. Ich verdanke ihm so viel.“ Er hält kurz inne. „Der See hat mir den Vater und die Mutter ersetzt.“
Es gibt Dutzende internationale Studien zum Victoriasee, Management-Pläne, Projekte für nachhaltige Fischerei und Aquakultur. In einer Analyse warnte die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) vor einem drohenden Kollaps der Victoriabarsch-Fischerei. Denn das nächste Drama bahnt sich schon an, seit chinesische Investoren den Export mit der getrockneten Schwimmblase des Barsches forcieren. Der Fischschlund gilt in China als Delikatesse und medizinisches Wundermittel – mit Kilopreisen bis zu 1000 Dollar. Eine Schattenwirtschaft entsteht, die Deals laufen an afrikanischen Fischern, Transporteuren, Agenten vorbei. Über das neue Geschäft zu reden gilt an den Ufern des Sees als Tabu.