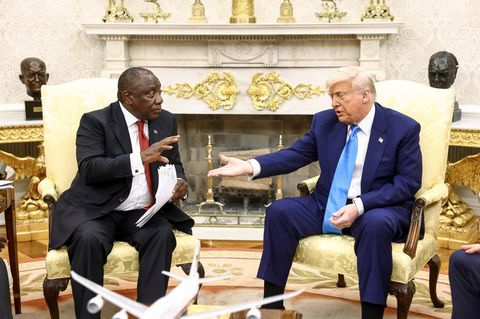Wilfred Mestile gehört in Südafrika zu den privilegierten Arbeitern. Seit sieben Jahren lebt er im Neubauviertel Sunnyridge, einer Siedlung, die Daimler-Chrysler für seine Arbeiter mitaufgebaut hat. Mestile, 42, wohnt in einem 45-Quadratmeter-Häuschen mit seiner Tochter und seiner Frau, die gerade in der Küche steht und ein Abendessen aus Maismehl und saurer Sahne zubereitet. Der Herr des Hauses sitzt auf dem Sofa unter einem Plastikhirschgeweih und berichtet über seinen Arbeitsalltag im Daimler-Werk East London. Mestile montiert an der Mercedes C-Klasse den Benzintank, normalerweise 40 Stunden pro Woche, seit März aber 45 Stunden, weil es so viele Autobestellungen gibt. Mit den Überstundenzuschlägen und Bonus kommt er auf 860 Euro brutto im Monat.
Thomas Langenbach arbeitet auch an der C-Klasse, allerdings in der Lackiererei im Daimler-Werk in Bremen. Er fährt täglich eine Stunde von Bremerhaven aus, wo er in einem Einfamilienhäuschen mit seiner Frau und den drei Söhnen lebt. Früher konnten sie noch Fahrgemeinschaften von Bremerhaven aus bilden, doch heute sind die Arbeitszeiten so verschieden, dass er oft allein fahren muss. Der 44-jährige Langenbach verdient 2.825 Euro brutto pro Monat und arbeitet 35 Stunden pro Woche. Hört sich im Vergleich zu Südafrika gut an. Aber: "Weihnachtsgeld, Einstiegslöhne, Feiertage wurden in den letzten Jahren schon reduziert", sagt Langenbach. "Die Zeiten, wo du dir hier die Nüsse schaukeln konntest, sind längst vorbei."
Artur Ziebarth schafft ebenfalls beim Daimler, im Werk Sindelfingen. Er ist gelernter Kfz-Mechaniker und legt Elektrokabel in die C-Klasse. Der 32-Jährige verdient 2.904 Euro brutto im Monat und lebt mit seiner Frau und den drei Kindern im Souterrain bei den Schwiegereltern. Die früher häufigen Nachtschichtzuschläge seien zwar gut gewesen, aber weil "der Daimler spart", werden kaum noch Nachtschichten gefahren. "Vor zwei Jahren haben bei uns in der Gruppe 21 Leute gearbeitet, heute müssen wir die gleiche Arbeit mit 18 Leuten erledigen."
Alle drei wurden in den vergangenen Wochen gegeneinander ausgespielt
Mestile in Südafrika, Langenbach in Bremen, Ziebarth in Sindelfingen: Alle drei arbeiten im gleichen Konzern, montieren das gleiche Auto. Und alle drei wurden in den vergangenen Wochen von Mercedes-Vorstand Jürgen Hubbert gegeneinander ausgespielt: In Südafrika fordern die Arbeiter zurzeit acht Prozent Lohnerhöhung. Die Werksleitung droht immer wieder damit, die Produktion nach Indien oder Namibia zu verlagern. Dort könne man die Luxuskarossen billiger bauen. In der Stuttgarter Daimler-Zentrale wiederum verlangte der Mercedes-Chef von den Betriebsratschefs aller deutschen Werke, dass sie jährlich 500 Millionen Euro sparen sollten, sonst würden in Sindelfingen 6.000 Arbeitsplätze gestrichen und die Produktion nach Südafrika und Bremen verlagert.
Während die Betriebsräte in Südafrika diese Woche noch verhandeln, akzeptierten die Kollegen in Deutschland das 500-Millionen-Sparpaket. Gut gelaunt trat Daimler-Chef Jürgen Schrempp (Jahresgehalt 5,4 Millionen Euro) vor die Fernsehkameras und lobte die Einigung, die "Modellcharakter für Deutschland" habe. Die Beschäftigten müssten "zwar teilweise etwas aufgeben. Dafür bekommen sie aber auch etwas sehr, sehr Wichtiges: die Stärkung unserer heimischen Standorte und damit eine langfristige Wohlstandsperspektive". Ob "langfristig" wirklich bis 2012 bedeutet, wie die geschwächte IG Metall und die Betriebsratschefs glauben, ist aber keineswegs sicher. Denn Mercedes-Chef Hubbert mäkelte bereits, er sei mit dem Kompromiss "nicht ganz zufrieden", weil man es nicht geschafft habe, die Privilegien der Arbeiter in Baden-Württemberg "in einem Schritt zu eliminieren". Für ihn sei aber klar, dass "der jetzt in Gang gekommene Prozess zur Abschaffung der baden-württembergischen Besonderheiten unumkehrbar ist".
Liebe Arbeiter, jetzt habt euch mal nicht so
Ökonomen finden es grundsätzlich logisch, dass ein Unternehmen seine Gewinne steigern will. Wenn man dazu mit Jobverlagerung ins Ausland drohen muss, ist das zwar nicht besonders nett, kann aber notwendig sein. Den Beschäftigten hingegen leuchtet diese Logik gelegentlich nicht ein. Das musste auch Helmut Lense spüren, Betriebsratsvorsitzender im Werk Stuttgart-Untertürkheim, als er vergangenen Freitag den so genannten Kompromiss mehreren tausend Daimler-Arbeitern auf einer Betriebsversammlung verkaufen musste. Lenses Kollege wurde ausgepfiffen, er selbst blickte auf Transparente, auf denen stand: "Wir haben nichts zu verschenken" und "Verzicht ist Beschiss". Nur mühsam konnte Lense, der auch im IG-Metall-Vorstand sitzt, die Beschäftigten davon überzeugen, dass sie ab 2007 knapp 2,8 Prozent weniger Lohn bekommen, dass das Kantinenpersonal, der Werksschutz und die Druckereiarbeiter künftig vier Stunden länger malochen müssen und die bezahlten Pausen für alle reduziert werden.
Die Wirkung dieses Abschlusses wird einen Dammbruch auslösen: Wenn schon die gut organisierten Daimler-Arbeiter so eine Kürzungsrunde akzeptieren, könnte demnächst jeder zweite Mittelständler Ähnliches von seiner Belegschaft fordern. Motto: "Liebe Arbeiter, jetzt habt euch mal nicht so, die Kollegen beim Daimler haben ja auch schon verzichtet."
Die Belegschaft schluckt das Sparpaket nur widerwillig
Sie wissen, dass Mercedes mit 3,1 Milliarden Euro Gewinn im vergangenen Jahr die erfolgreichste Sparte des Daimler-Konzerns war, aber sie wissen auch, dass andere Autobauer noch mehr Gewinn machen, BMW zum Beispiel, und dass die Shareholder-Value-Logik heute zählt. Außerdem steckt ihnen die Meldung in den Knochen, dass McKinsey jeden zehnten Daimler-Mitarbeiter für überflüssig hält. Und sie merken natürlich auch, dass ihre Betriebsräte dieser Logik nichts entgegenzusetzen haben, dass die IG Metall nur noch mit dem Mund stark ist. Schließlich steht ja jeden Tag in der Zeitung, dass Firmen tatsächlich ihre Produktion nach Osteuropa oder gleich nach Asien verlagern. VW beispielsweise stellt heute schon mehr Fahrzeuge in China als in Deutschland her. "Wenn der Betriebsrat gesagt hätte, dass ein Streik was nutzt, dann hätten wir auch gestreikt", sagt Artur Ziebarth aus Sindelfingen, "aber es gab wohl keine Alternative."
Ziebarth muss aufgrund der neuen Pausenregelung auf 40 Euro brutto im Monat verzichten, von 2007 an auf weitere 85 Euro. Heute hat er 2.150 Euro netto, von 2007 an werden es nur noch etwa 2.090 Euro sein. "Das bringt mich nicht um", sagt Ziebarth. "Schlimmer wär' doch auch, wenn ich einer von denen wäre, die man für überflüssig hält und in drei Jahren kündigt." Dennoch stört ihn das Klischee, wonach der Arbeitstag in Sindelfingen fast nur aus Pausen besteht. In den 14 Jahren, die Ziebarth nun beim Daimler schafft, habe es viele kleine Veränderungen gegeben, die immer nur auf eines hinausliefen: alles effektiver zu machen. Die Arbeitstakte seien erhöht worden, also die Minuten und Sekunden verkürzt, in denen man einen bestimmten Arbeitsgang erledigt haben muss. "Ich kann nicht mal aufs Klo gehen, ohne mir eine Vertretung zu organisieren, weil sonst das Band stoppt." Einmal in der Woche spielt Ziebarth Fußball in einer Hobbymannschaft. Wenn er danach mit den anderen beim Bier zusammensitzt, heißt es auch: "Euch beim Daimler geht's ja noch gut", aber das sei ein bisschen zu einfach gedacht. "Vielleicht haben wir sicherere Arbeitsplätze als in einem Kleinbetrieb, vielleicht verdienen wir auch mehr, aber ich hab auch viel mehr Druck, ich muss für mein Geld viel schneller schaffen als in einem Kleinbetrieb."
"Wir produzieren die gleiche Qualität wie die Deutschen"
Wilfred Mestile in Südafrika sagt auch, dass er nach der Schicht todmüde nach Hause komme, ihn ärgert zudem, dass er so wenig verdiene, dass er sich kein Auto und keinen Urlaub leisten könne. "Wir produzieren die gleiche Qualität wie die Deutschen", sagt Mestile, "es ist unfair, dass wir so viel weniger verdienen." Schließlich würden die Autos ja nicht verkauft mit der Bezeichnung "Hergestellt in Südafrika", sondern als Mercedes. "Das Management aber sagt uns immer, wir müssten flexibel sein, sonst drohen sie, dass sie hier weggehen."
Was in Deutschland die IG Metall, ist in Südafrika die National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA). NUMSA-Regionalchef Patrick Bazi, 46, hat die Diskussion bei Daimler in Deutschland in den vergangenen Wochen genau verfolgt. "Natürlich wäre es schön gewesen, wenn noch mehr Jobs nach Südafrika gekommen wären - aber nicht auf Kosten deutscher Arbeiter", sagt er. "Morgen würden die Manager dann uns erpressen." Als die südafrikanischen Daimler-Arbeiter 2001 mehr als zwei Wochen lang für höhere Löhne streikten, drohte ihnen das Management sogar kurioserweise damit, die Produktion zurück nach Deutschland zu verlegen, berichtet Bazi. Kein Wunder: In kaum einem Land wird so wenig gestreikt wie in Deutschland: In Italien kommen auf 1.000 Beschäftigte pro Jahr 177 Streiktage, in Dänemark 45, in den USA 43, in Großbritannien 26, in Frankreich 23, in Deutschland aber nur fünf.
Lotterien zur Mitarbeitermotivation
Zum Ausspielen der Standorte gehört auch, dass man die Probleme der afrikanischen oder asiatischen gern mal verschweigt. Norbert Otten, Daimler-Chrysler-Manager in Südafrika, muss beispielsweise zugeben, dass "neun Prozent unserer Angestellten mit HIV infiziert oder schon an Aids erkrankt sind". Ein anderes Problem sind die Fehlzeiten. Um die Mitarbeiter zu motivieren, jeden Tag ins Werk zu kommen, veranstaltet Daimler-Chrysler in East London Lotterien: Unter den Arbeitern, die nur einen bis drei Tage pro Jahr krank waren, werden Fernseher, Kühlschränke und Mobiltelefone ausgelost. Arbeiter, die gar keine Fehltage haben, können sogar einen Mitsubishi Colt gewinnen. Und der gefürchteten "baden-württembergischen Krankheit" kann Mercedes-Chef Hubbert nicht mal in Südafrika entgehen: Dort wird bereits ab 14.40 Uhr ein Spätschichtzuschlag von zehn Prozent gezahlt.