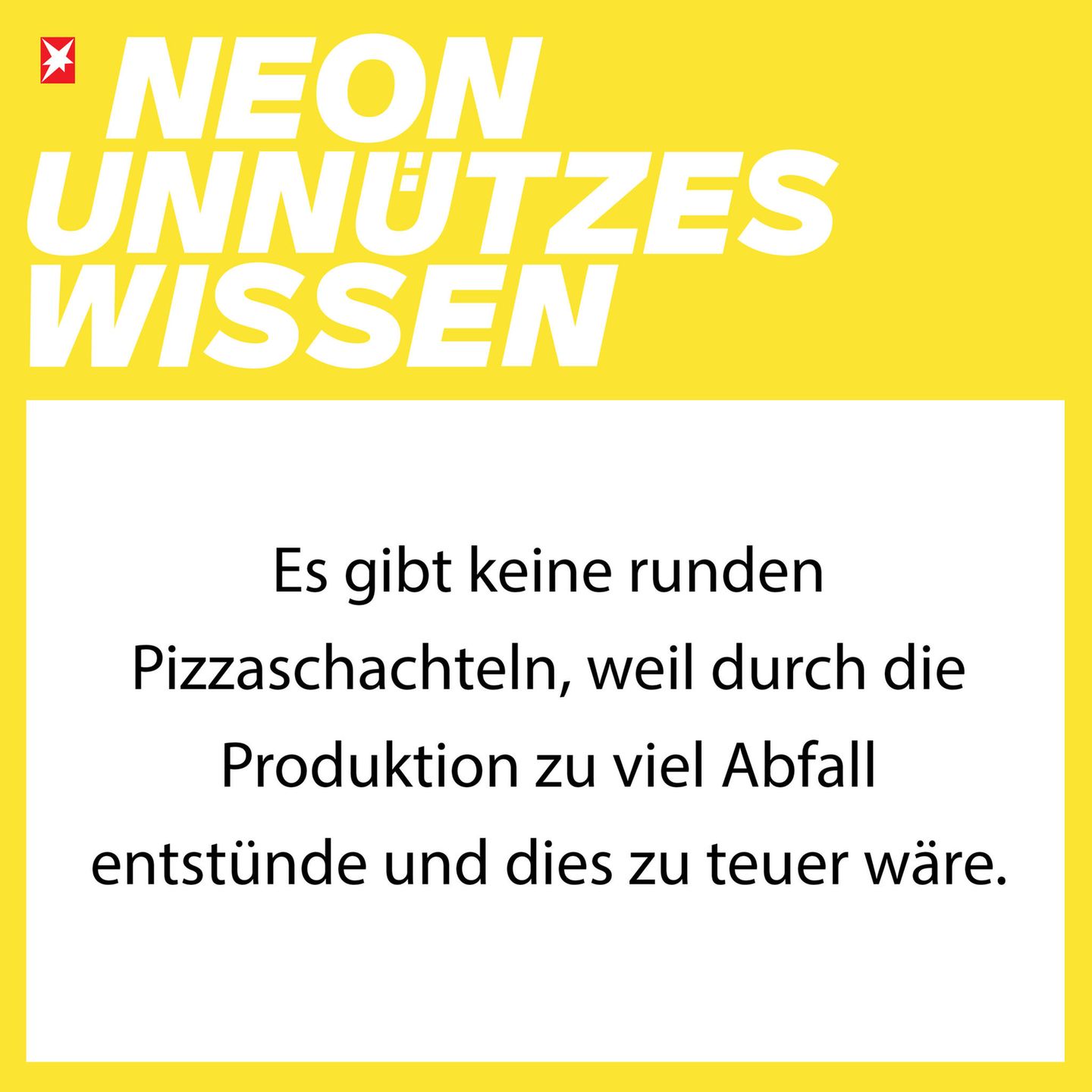Anke Boisch lässt den braunen Kompost durch ihre Finger rieseln. Es ist nicht bloß Erde. Bei genauem Hinsehen sind Blätterfasern und Stöckchen zu erkennen. "Feinster Kompost", sagt sie. "Er riecht schön erdig – wie Waldboden." Doch im Grunde ist es nur Abfall, ein Produkt aus Müll. Denn der Kompost, den Hamburger auf den Recyclinghöfen für 3,50 Euro pro 30-Liter-Sack kaufen können, besteht aus dem Müll, den man am liebsten schnell aus der Küche haben will.
Gammelige Kartoffelschalen, nicht gegessene Äpfel und mit Schimmelflaum überzogene Orangen, die Reste vom Mittagessen - was bei Anke Boisch, der Chefin des Biogas- und Kompostwerks in Bützberg abgeladen wird, ist eine Herausforderung für die Nase. Dazu kommen Gartenabfälle, abgeschnittene Sträucher und die Überreste vom Rasenmähen. Die Anlage vor den Toren Hamburgs ist eine der größten ihrer Art in Deutschland. Hier entsteht aus Müll Energie.
Bioabfall kann Haushalte mit Strom versorgen
Dafür werden alle zwei Woche die grünen oder auch mal braunen Tonnen aus Hamburg abgeholt. Rund 134.000 Biotonnen gibt es bereits. Das klingt für eine Stadt mit mehr als 1,8 Millionen Einwohnern nicht viel. Doch laut Stadtreinigung haben 93 Prozent aller Haushalte, bei denen eine Aufstellung möglich ist, Zugang zu einer Biotonne. Das sind 620.000 Haushalte, wesentlich mehr Menschen werden aber dadurch erreicht. Jährlich werden in der Anlage bis zu 70.000 Tonnen Bioabfall verwertet, mehr als 60.000 Tonnen davon aus Hamburger Haushalten. "Aus einer Tonne Bioabfall werden bei uns bis zu 450 Kilowattstunden Energie hergestellt", sagt Boisch. Insgesamt kann das Biogaswerk Bützberg rund 11.000 Zwei-Personen-Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgen.
Doch bis der Bioabfall zu Energie und Kompost wird, muss er einige Schritte durchlaufen: Die vollen Müllwagen kippen den Bioabfall in einer Anlieferhalle auf den Boden. Orangen- und Zitronenschalen heben sich von der grün-bräunlichen Masse ab. Auch Äste und Gartenschnitt sind dabei: Der holzige Abfall wird im Hackschnitzelofen zur Energieerzeugung vor Ort oder in anderen Anlagen verbrannt.
Plastiktüten sind der schlimmste Feind
Durch Siebe und Magnetabscheider wird der Müll zunächst von größeren Gegenständen befreit, auch Plastik und Metalle werden so rausgeholt. "Der Bürger schmeißt nicht immer alles in die richtige Tonne. Da kommt auch mal eine Puppe an, oder ein Stofftier oder Gartenschuhe. Wir haben auch ein paar Metalle wie Gartengeräte oder Messer und Gabel", sagt Boisch. Aber auf die Gesamtmenge von 55.000 bis 60.000 Tonnen seien 10 Tonnen Metall relativ wenig. Die Metalle kommen in die Schrottverwertung, die Kunststoffe und anderes gehen in die Müllverbrennungsanlage, da diese durch den Biomüll oft zu sehr verschmutzt sind, um sie anderweitig zu recyceln. Besonders schwierig ist Glas im Bioabfall. Denn bisher gibt es kein geeignetes Verfahren, um es zu entfernen. Also muss es per Hand aussortiert werden.
Doch der viel schlimmere Feind von Anke Boisch sind Plastiktüten. "Ich halte nichts von denen. Sie haben den Nachteil, dass sie petro-chemische Bestandteile haben, die nicht gut abbaubar sind", sagt sie. Denn der Kompost, um ihn mit den Gütesiegeln verkaufen zu können, darf nur 0,1 Prozent Verunreinigungen enthalten. Biomüll sollte daher in Papiertüten gesammelt werden. Die bekommen Hamburger gegen Vorlage eines Gutscheins auf Recyclinghöfen oder bei der Drogeriekette Budni.
So wird aus Abfall umweltfreundliche Energie
Ist das Material vorbereitet, bringen große Radlader es in die Fermenter. Hier entsteht das Biogas. "Das muss man sich vorstellen wie eine Großgarage", sagt Boisch. Die 21 Gärkammern sind jeweils 24 Meter lang, 4,5 Meter hoch und 5 Meter breit. Oben bleibt ein kleiner Freiraum für das Biogas. Das riesige Tor wird luftdicht verschlossen und der Fermentierungsprozess kann beginnen: Gas bildet sich, sobald der Sauerstoff verbraucht ist. Um den Vorgang zu beschleunigen, werden die Hallen erwärmt. Unter den Fermentern befindet sich Perkolat, also bei der Gärung austretende Flüssigkeit – ähnlich wie Gülle. Dieses Perkolat wird wiederrum gemischt und von oben zugeführt, um die Biomasse feucht zu halten. So wird sie mit Bakterien angereichert, wodurch der Fermentierungsprozess schnell abläuft.

Bei Temperaturen von 38 Grad fühlen sich die Mikroorganismen am wohlsten. Das Gas wird in drei Speichern auf dem Dach aufgefangen. Anschließend wird das Rohgas in einer Anlage aufbereitet und als Biomethan ins öffentliche Gasnetz eingespeist. So landet es entweder direkt in den Haushalten oder es wird zur Produktion von umweltfreundlicher Energie in einem Blockheizkraftwerk genutzt.
Die Fermentation dauert in der Regel 12 bis 13 Tage, danach wird bis zu zwei Tage gelüftet. "Erst wenn wir durch unsere Messgeräte feststellen, dass kein Biogas mehr im Fermenter vorhanden ist, können wir die Tür öffnen", sagt Boisch. Was dann rauskommt, ist warmer Gärrest, ähnlich dem Mist aus der Landwirtschaft.
Pilze und Bakterien machen aus Abfall Kompost
Doch hier ist noch nicht Schluss: Die Gärreste werden mit etwas frischem Bioabfall gemischt und kommen in die große 22 Meter breite und 125 Meter lange dunkle "Rottehalle", wo sie zu Kompostmieten aufgehäuft werden. Bei Temperaturen von über 60 Grad sorgen Milliarden kleiner Pilze und Bakterien dafür, dass richtiger Kompost entsteht. "Hier kann man manchmal kaum zwei Meter weit gucken, wenn es draußen kalt ist", sagt Heinrich Holst-Oldenburg, der sich um die Vermarktung des Komposts kümmert. Etwas Wasser tropft von der Decke auf seinen gelben Sicherheitshelm. Es ist warm, die Luftfeuchtigkeit enorm, der Kompost dampft.
Die Temperatur in den Mieten wird genau überwacht. "Mindestens eine Woche lang müssen Temperaturen über 60 Grad nachgewiesen werden können, damit auch Salmonellen und Bakterien vollständig abgetötet sind", sagt Boisch. Nach fünf Wochen ist der Prozess abgeschlossen - aus miefendem Biomüll ist Kompost geworden.
Mehr zum Thema Müll finden Sie im aktuellen Heft: