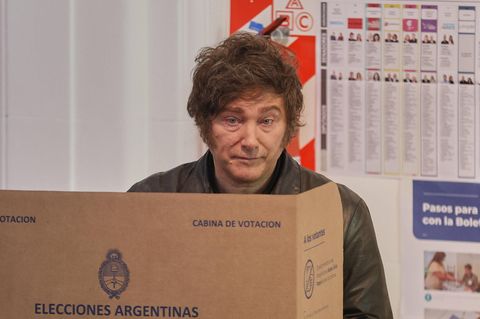Der Apfel ernährt die Familie. Luis Molinez, seine Frau Francisca und die fünf Kinder, den Großvater Aurelio, die Hühner und die Hunde. Von seinem Steinhaus aus sieht Luis die Apfelbäume. Er ist auf der Leiter aufgewachsen - so nennen sie es hier, wenn einer als halbes Kind Pflücker wird. Luis sitzt auf seiner Terrasse unterm Laubendach, die jüngste Tochter Ailin auf dem Schoß. Die Anderthalbjährige nuckelt schon mit dem Strohhalm Mate-Tee, das koffeinhaltige argentinische Nationalgetränk. Im Liegestuhl döst ein kleiner Hund, Hühner picken Brotkrümel von der Terrasse. Das ist die Welt des Luis Molinez.
Nachts träumt er manchmal von Äpfeln, rotbackigen Galas und quietschgrünen Granny Smiths. Schon sein Vater hat als Pflücker gearbeitet, seine Frau hilft in der Fabrik beim Verpacken der Früchte. Nur sein ältester Sohn Augustin ist aus der Art geschlagen, er mag lieber Bananen und würde gern nach Europa. Aber Europa, murmeln die anderen Molinez, das ist doch so groß und so fern.
Noch nie weg aus dem Apfeltal
Luis war mit seinen 39 Jahren noch nie weg aus dem Apfeltal der argentinischen Provinz Rio Negro. Luis ist das Gegenteil von Globalisierung. Er kann sich nicht vorstellen, dass der Apfel, den er eben noch in der Hand hatte, übers Meer fahren wird, in dieses ferne Europa. Dass der Apfel nicht nur Luis' Familie satt macht, sondern auch die des Kapitäns Robert Palmez auf den Philippinen und des Matrosen Fualau Gabata vom Südseeinselchen Tuvalu. Dass er im Hafen von Rotterdam ankommen wird, mit dem Lieferwagen weiter nach Köln muss und am Ende von einer deutschen Familie aufgegessen werden wird. Luis war noch nie am Meer.
Rund 13.000 Kilometer wird der Apfel reisen, bis er als argentinischer Bioapfel in einem deutschen Laden liegt. Und nicht nur Luis fällt es schwer, diesen langen Weg zu begreifen. Für viele Käufer in Deutschland bleibt er genauso unverständlich: Zitronen, Ananas, Kiwis - die wachsen nun mal nicht nebenan. Aber warum muss man ein urdeutsches Obst wie den Apfel herankarren? Fast 90 Prozent der Verbraucher wünschen sich mehr Lebensmittel aus der Region - gleichzeitig liegen in Supermärkten und Ökoläden immer mehr Äpfel von großen Plantagen aus Argentinien oder Neuseeland. Der Export argentinischer Bioäpfel nach Westeuropa hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdreifacht auf 10.000 Tonnen. Deutsche Biobauern klagen über die globale Konkurrenz.
Der Ökomanager übernimmt
An der Reise des Apfels vom Rio Negro zeigen sich besonders deutlich die Widersprüche der Biobranche: Weil immer mehr Menschen ökologische Lebensmittel kaufen, entsteht eine weltweite Industrie, wie es sie bei konventionellen Lebensmitteln schon lange gibt. Der Wollstrumpfzausel mit seinen glücklichen Möhren stirbt aus, der Ökomanager übernimmt. Doch darf sich Luis' Apfel noch "Bio" nennen? Sind Äpfel aus Übersee Klimakiller? Oder ist Bioanbau immer und überall gut, für die Erde, für die Menschen?
Der Apfel ernährt da s Dorf. "Hier ist Apfelland", sagen die Einwohner. Eine Oase mitten in der patagonischen Steppe. Ein fruchtbares Tal, gespeist vom Fluss Rio Negro, der den verschneiten Gipfeln der Anden entspringt. Man fährt vorbei an Obstplantagen und an Allen, der Stadt der Birne, nach General Roca, der Stadt des Apfels. Am Ortseingang haben sie ihm ein riesiges Denkmal gebaut: einen silbernen Metallapfel, abends wird er mit rotem Licht angestrahlt. Im örtlichen Jeansladen spielen zwei nackte Schaufensterpuppen die Geschichte von Adam und Eva nach, sie reicht ihm lächelnd die verbotene Frucht.
Eine Plage folgte der nächsten
Enrique Scholz hat den Sündenfall schon hinter sich. Nach dem Landwirtschaftsstudium in Buenos Aires vertrieb er für große Chemiefirmen Pestizide. Die Mittel töteten alle Lebewesen auf den Äckern, auch die nützlichen Insekten, die Feinde der Schädlinge. Eine Plage folgte der nächsten. Die Pestizide wurden immer schärfer. "Ich führte Krieg gegen die Natur", sagt Enrique Scholz. Er beschloss abzurüsten. Bei Wissenschaftlern in den USA informierte er sich über biologische Methoden der Schädlingsbekämpfung. Schließlich kaufte er Brachland am Fluss und wurde der erste Biobauer Argentiniens. Anfang der 90er Jahre war das.
"Mein Gott ist die Natur", sagt der 70- jährige Scholz heute. So spricht ein Geläuterter, der Paulus vom Apfeltal - und doch klingen seine Worte nicht pathetisch, sondern pragmatisch. Scholz ist immer noch Geschäftsmann: "Obwohl mich alle für verrückt erklärten, habe ich auf Bio gesetzt - und gewonnen", sagt er.
Scholz hat den Traum seines Vaters wahr gemacht, der Anfang der 1920er Jahre als deutscher Matrose nach Argentinien kam. In Deutschland herrschte damals die große Inflation, Argentinien aber war Wirtschaftswunderland. "Reich wie ein Argentinier", hieß es in Europa. Scholz, der immer noch fließend Deutsch spricht, ist heute Herr über 300 Hektar Land, er gibt rund 200 Menschen Arbeit auf seinen Apfel- und Birnenplantagen und in der Packerei. Mehr als 1800 Pesos verdienen die Erntearbeiter, fast 450 Euro, knapp 20 Prozent mehr als der argentinische Durchschnittslohn.
"Schön rot und nicht zu klein"
Am Morgen kommen sie mit dem Fahrrad zum Feld. "Venga, venga", auf geht's! Die Pflücker schultern ihre langen roten und gelben Leitern und laufen los zwischen die Baumreihen. Heute wird der Gala geerntet, ein süßer Apfel, der im Ausland besonders beliebt ist. Es ist früher Morgen, auf den Blättern liegt noch Tau, doch das Licht ist schon gleißend und hart. In Deutschland ist jetzt Frühling, in Argentinien Frühherbst. Gegen Mittag sind es 40 Grad. Luis, der nach all den Jahren als Pflücker jetzt Vorarbeiter ist, betrachtet den Apfel, den der junge Martin Chavez eben geerntet hat, und ist zufrieden: "Schön rot und nicht zu klein."
Nach der Siesta gehen die Pflücker noch einmal jede Baumreihe ab, suchen rotbackige Äpfel, die sie übersehen haben. Aufwendig ist die Apfelernte, und die Ernte von Bioäpfeln ist noch aufwendiger: Das Unkraut wird nicht mit Herbiziden weggespritzt, sondern mit dem Traktor und der Sense gemäht. Auf konventionellen Plantagen wächst unter den Obstbäumen meist kein Gras mehr. Auf Enrique Scholz' Farmen wuchern Gräser, kriechen Schlangen, hüpfen Kröten. Luis glaubt, dass auch die Menschen hier besser leben: "Früher, als ich noch auf konventionellen Plantagen arbeitete, hatte ich an den Tagen, an denen gespritzt wurde, abends Bauchweh, ein paarmal musste ich mich übergeben." Luis sagt, jetzt fühle er sich sicher.
Sie sucht nach Opfern
Mit einem Stroh-Sombrero auf dem Kopf läuft Enrique Scholz über die Plantage. Er betrachtet durch eine Lupe ein Blatt: "Da läuft eine kleine weiße Raubmilbe im Zickzack, sie sucht nach Opfern." Scholz freut sich über jede Raubmilbe, denn sie frisst Schädlinge.
Sein Obst wird regelmäßig von Kontrolleuren geprüft und trägt das Biosiegel. Scholz' wichtigste Kunden sitzen in Europa und den USA. Die amerikanische Bio- Supermarktkette "Whole Foods Market" kauft bei ihm - und in deutsche Babygläschen kommen auch Enriques Birnen. "Die ganze Welt isst unsere Früchte", sagt ein Pflücker, "nur die Argentinier essen sie nicht." In Argentinien gibt es keinen Markt für Bioprodukte. Noch nicht. Dafür boomt der Anbau von Ökoobst. Längst ist Enrique Scholz nicht mehr der einzige Biobauer im Tal. Ökoobst bringt mehr Profit als konventionelles. Große Firmen kaufen Farmen auf und stellen auf biologischen Anbau um. Noch kann sich Scholz gegen die Konkurrenz behaupten. "Aber ich will nicht noch größer werden. Wir waren immer Mittelständler, ein Familienunternehmen."
Zurück bleibt braunes Wasser
Am nächsten Morgen geht der Apfel baden. In einer großen Halle werden die Früchte in eine Waschanlage gekippt. Sie tauchen unter, werden hochgespült und schwimmen auf Förderbändern weiter. Zurück bleibt braunes Wasser. Große Ventilatoren pusten die Äpfel trocken. Sie fahren zu den Sortiererinnen: Die Frauen tragen weiße Handschuhe, um die Schale nicht zu beschädigen. Sie rollen die Äpfel in den Händen prüfend hin und her, dann verteilen sie sie: die makellosen aufs obere Förderband, die mit Kerben oder Sonnennarben aufs untere.
Vorbei die Zeit der Runzeläpfel. Auch der Bioapfel soll jetzt aussehen wie ein Industrieapfel - genormt, immer gleich schön. Nur ein paar Sorten eignen sich für den Export, für die lange Reise. Enrique Scholz' Favorit ist eigentlich der Red Delicious: "Der ist am besten fürs Immunsystem. Aber er wird schnell mehlig. Wir exportieren jetzt mehr Galas." Alle Bioäpfel, die nicht perfekt sind - und das ist knapp die Hälfte - gehen auf konventionelle Märkte, zu Kunden, die weniger bezahlen, nach Russland zum Beispiel. Und die ollen Früchte kommen in die Saftfabrik und werden als Konzentrat exportiert.
Liliana packt 400, Liliana ist die Beste
Die schönen Äpfel werden maschinell nach Gewicht sortiert und fallen auf gepolsterte Drehtische. Hier packt Liliana Pantano den Apfel. Schweiß rinnt ihr geschminktes Gesicht hinab. Ihre schlanken Beine hat sie fest in den Boden gestemmt, nur der Oberkörper schwingt hin und her, mit beiden Händen greift sie immer neue Äpfel und legt sie in Pappkartons mit kleinen Mulden, 100 passen in eine Kiste. Ein durchschnittlicher Packer schafft 200 Kisten am Tag. Liliana packt 400, Liliana ist die Beste. Ihre Leistungsprämie ist höher als die aller anderen Kollegen, fast 1000 Euro verdient sie in guten Monaten. Weil die 42-jährige Mutter von vier Kindern in der Apfelsaison den Haushalt nicht mehr schafft, leistet sie sich eine Putzfrau.
In den Lagerräumen haben sich die Angestellten dicke Vliesjacken übergezogen. Hier wird der Apfel runtergekühlt, zwölf Stunden bei minus vier Grad. Danach wird er konstant bei null Grad gelagert, bis zu seiner Ankunft in Deutschland. "Die Äpfel schlafen legen", nennt man das - damit sie frisch und knackig wieder aufwachen. An einem Sonntagmorgen werden die Äpfel in einen Lastwagen verladen. Zum Schiff sind es noch 400 Kilometer durch die öde Steppe Patagoniens. Irgendwann das Meer. Badegäste liegen im hellen Sand und schauen den Schiffen zu, die im kleinen Hafen San Antonio Waren einladen.
Auf den Meeren aber verdient man gut
Die Apfelkisten werden in einen Kühlcontainer umgepackt, der ebenso groß ist wie der Lkw. Mit einem riesigen Kran wird der Container auf ein Schiff gehievt. Die Mannschaft besteht nur aus Filipinos. Kapitän Robert Palmez fährt zehn Monate im Jahr zur See, nur zwei Monate sind für die Familie reserviert. So oft wie möglich mailt er seiner Frau Michelle und seiner zehnjährigen Tochter Eliza. Er schreibt: "Wenn ich in Rente gehe, kaufen wir uns ein Haus unter Palmen und sind füreinander da." Palmez ist 36. Auf den Philippinen gibt es kaum Arbeit, auf den Meeren aber verdient man gut. Als Palmez den Befehl zum Ablegen gibt, ist es tiefe Nacht.
Von San Antonio, dem kleinen Hafen in Argentinien, fährt Palmez nach Montevideo, der Hauptstadt des Nachbarstaates Uruguay. Dort wird der Apfel-Container auf ein noch größeres Schiff, die Maersk Jakarta, umgeladen. Nach Zwischenstopps in den brasilianischen Häfen Paranaguá und Santos geht es nach Europa. Der Südatlantik ist ruhig, doch im Norden toben Stürme. Regen trommelt auf das Deck der Maersk Jakarta, als sie 17 Tage später den Hafen von Rotterdam erreicht.
"Ich bin so stolz auf ihn"
Nur zehn Stunden bleiben zum Verladen der insgesamt fast 3000 Container. Die Matrosen auf der Maersk Jakarta kommen alle von der Südseeinsel Tuvalu. Einer von ihnen ist Fualau Gabata. Er hat noch zwei Jahre bis zur Rente. Von seinem Sold finanziert er seinem Sohn ein Chemiestudium. "Ich bin so stolz auf ihn", sagt Fualau. Wie große weiße Legosteine liegen die Container schließlich aufgestapelt im Terminal, die Kühlaggregate summen laut. Rindfleisch, Gemüse und Enrique Scholz' Äpfel sind jetzt in Europa. Der Schiffstransport hat gerade mal zehn Cent pro Kilo Obst gekostet.
Vom Hafen fahren die Äpfel zur Firma Eosta, einem der weltweit größten Händler von Bioobst. Eosta beliefert vor allem deutsche Naturkostläden und Supermärkte - Edeka, Plus, auch Aldi und Lidl. In den Büroräumen in Waddinxveen bei Rotterdam zeigen Uhren die Ortszeit in den Ländern an, mit denen Eosta die meisten Geschäfte macht: Argentinien, China, Neuseeland, Mexiko, Südafrika. Die Firmenzentrale arbeitet "CO2-neutral": Bei jeder Dienstreise und jeder Stromrechnung aus dem Kühllager rechnet Eosta die Kohlendioxid-Emissionen aus und überweist einen entsprechenden Betrag, etwa an Aufforstungsprojekte für Regenwälder in Indonesien. Bald soll auch sämtliches Übersee-Obst "kompensiert" werden - der "klimaneutrale" Apfel ist das Ziel.
Nächster großer Trend: "Regionalität"
Man weiß nicht, was an diesen Ideen Idealismus ist und was Marketing. Eosta-Chef Volkert Engelsman weiß, dass Bioware nach anderen, wenn man so will, nach moralischeren Maßstäben bewertet wird. Er weiß auch, dass der nächste große Trend "Regionalität" heißt. Je globaler und unpersönlicher die Biobranche wird, desto mehr Menschen sehnen sich zurück nach der heimischen Scholle, nach dem netten Bauern um die Ecke, dem sie beim Apfelpflücken zusehen können. In Deutschland gibt es Kampagnen wie "Regional ist erste Wahl". In den USA treffen sich Konsumpatrioten auf Webseiten wie eatlocalchallenge.com.
Eosta-Chef Engelsman bekämpft Kritiker mit ihren eigenen Waffen: Auf all seinen Waren klebt jetzt ein Plastikpunkt mit einer Nummer. Auf Enrique Scholz' Äpfeln ist es die 301. Der Käufer kann sich damit im Internet zur Farm am Rio Negro klicken. Der argentinische Bauer bekommt ein Gesicht und einen Namen, fast so wie der von nebenan. Deutsche Ökobauern müssen mit denen in Südamerika oder Tschechien konkurrieren. Die Arbeitskräfte sind im Ausland billiger, das drückt die Preise. Jetzt drängt auch noch China auf den Biomarkt. China ist der weltgrößte Apfelproduzent, jeder dritte Apfel wächst dort. Der Apfel mit der Nummer 301 liegt jetzt im Lager von Eosta. Ein süßlicher Geruch hängt in der Luft. Ein Kontrolleur sucht nach Schönheitsfehlern, misst den Druck im Apfel und den Zuckergehalt. "Süß, aber nicht überreif ", so das Fazit.
"Köln ist der Flaschenhals"
Ein paar Wochen später werden die Äpfel abends in den Lastwagen verladen, am Morgen sind sie im Kölner Großmarkt. Die Filiale Köln-Sülz der größten deutschen Bio-Supermarktkette "Alnatura" will Äpfel aus Argentinien. Insgesamt gibt es 30 Alnatura-Filialen, fast alle paar Wochen wird eine neue eröffnet. Aberwitzig: Selbst deutsche Bioäpfel vom Bodensee werden oftmals per Lkw nach Köln gefahren und reisen danach zurück in den Alnatura-Markt nach Konstanz. "Köln ist der Flaschenhals, wo fast alles durch muss", bestätigt Alnatura-Managerin Manon Haccius. "Dort wird die Ware zentral verpackt und etikettiert." Man bemühe sich aber um Kooperationen mit Lagern in Süddeutschland, sagt Haccius.
Am frühen Morgen hält ein Lieferwagen mit frischem Obst und Gemüse vor der Alnatura-Filiale in der Berrenrather Straße in Köln. Der stellvertretende Marktleiter Tim Waldmann räumt die argentinischen Äpfel ein. Er schneidet einen Apfel auf und drapiert die Spalten zum Probieren in eine Schale. Daneben liegen noch Äpfel aus Neuseeland, aber auch unterschiedliche Sorten aus der Region. Alle sehen zum Anbeißen aus. Welchen soll man jetzt kaufen? Ist jeder, der zu Äpfeln aus Übersee greift, eine Umweltsau?
163 Gramm Kohlendioxid pro Kilo Äpfel
Auf dem langen Weg vom Rio Negro an den Rhein entstehen rund 163 Gramm Kohlendioxid pro Kilo Äpfel. Zum Vergleich: Neuwagen stoßen auf einem Kilometer im Schnitt 160 Gramm Kohlendioxid aus. Wer mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zum Einkaufen fährt, macht den Klimaschaden von Enriques Äpfeln also theoretisch wieder wett. Das hat die Firma Eosta berechnet. Ulrike Eberle vom Freiburger Öko-Institut hält die Eosta- Rechnung für durchaus realistisch.
Außerdem: Auch deutsche Äpfel werden nach der Ernte im Herbst lange bei niedrigen Temperaturen gelagert - sie sollen frisch schmecken bis in den nächsten Sommer hinein. Irgendwann im Frühjahr kippt dann die CO2-Bilanz, so Ulrike Eberle: "Im April verursacht ein deutscher Apfel wegen der energieintensiven Lagerung oft mehr Treibhausgasemissionen als ein argentinischer, der frisch geerntet wurde und mit dem Schiff hierher kommt."
Am besten ist bio regional - und saisonal
Also alles paletti, rein mit dem Argentinier in den Einkaufswagen? Nicht unbedingt, meint Eberle: "Es gibt viele gute Gründe für Äpfel aus der Region, die bei der CO2-Debatte völlig untergehen." Wenn Leute aus der Stadt zum Biobauern aufs Land fahren, sehen sie die Streuobstwiesen, die Spechte auf den Bäumen. Sie lernen alte Apfelsorten kennen, die es nur noch vor der eigenen Haustür gibt. Martin Demmeler, Agrarwissenschaftler an der Technischen Universität München, würde regionalen Produkten den Vorzug geben. Er findet es besorgniserregend, "dass sich die Transporte von Lebensmitteln in den letzten 15 Jahren verdoppelt haben - mit negativen Folgen wie Straßenschäden, Lärm, Abgasen". Demmelers Credo: "Bio global ist zwar besser als konventionell global. Aber am besten ist bio regional - und saisonal." Man müsse doch im Juli keine einge- lagerten deutschen oder argentinischen Äpfel essen - da gebe es eben Blaubeeren.
Langsam füllt sich der Alnatura- Supermarkt. Studenten, junge Eltern und Rentner schieben ihre Einkaufswagen. Ein Paar mit Baby beißt in die Apfelspalten: "Ist der lecker!" Jens Lindemann und Aurelia Heins sind Anfang 30, und spätestens seit ihre Tochter Luiza auf der Welt ist, essen sie fast nur noch Bio. Er kauft lieber deutsches Obst, "um unsere Bauern zu unterstützen". Ihr ist die Herkunft wurscht. Dass der Apfel, den sie genüsslich kaut, auch Luis' Familie ernährt, dass er der Packerin Liliana und ihrer Putzfrau Arbeit gibt und dem Sohn von Fualau Gabata das Studium finanziert - "egal, Hauptsache Bio." Die Familie kauft ein Kilo von Enrique Scholz' Äpfeln, dazu noch Biomüsli und Biobabytee, und geht zum Auto. Es passt zu ihnen - hübsch und trendy. Nur leider eine Dreckschleuder: ein altes blaues Mercedes-Coupé 250 C, ersteigert bei Ebay. Versaut dem Apfel die ganze Ökobilanz.