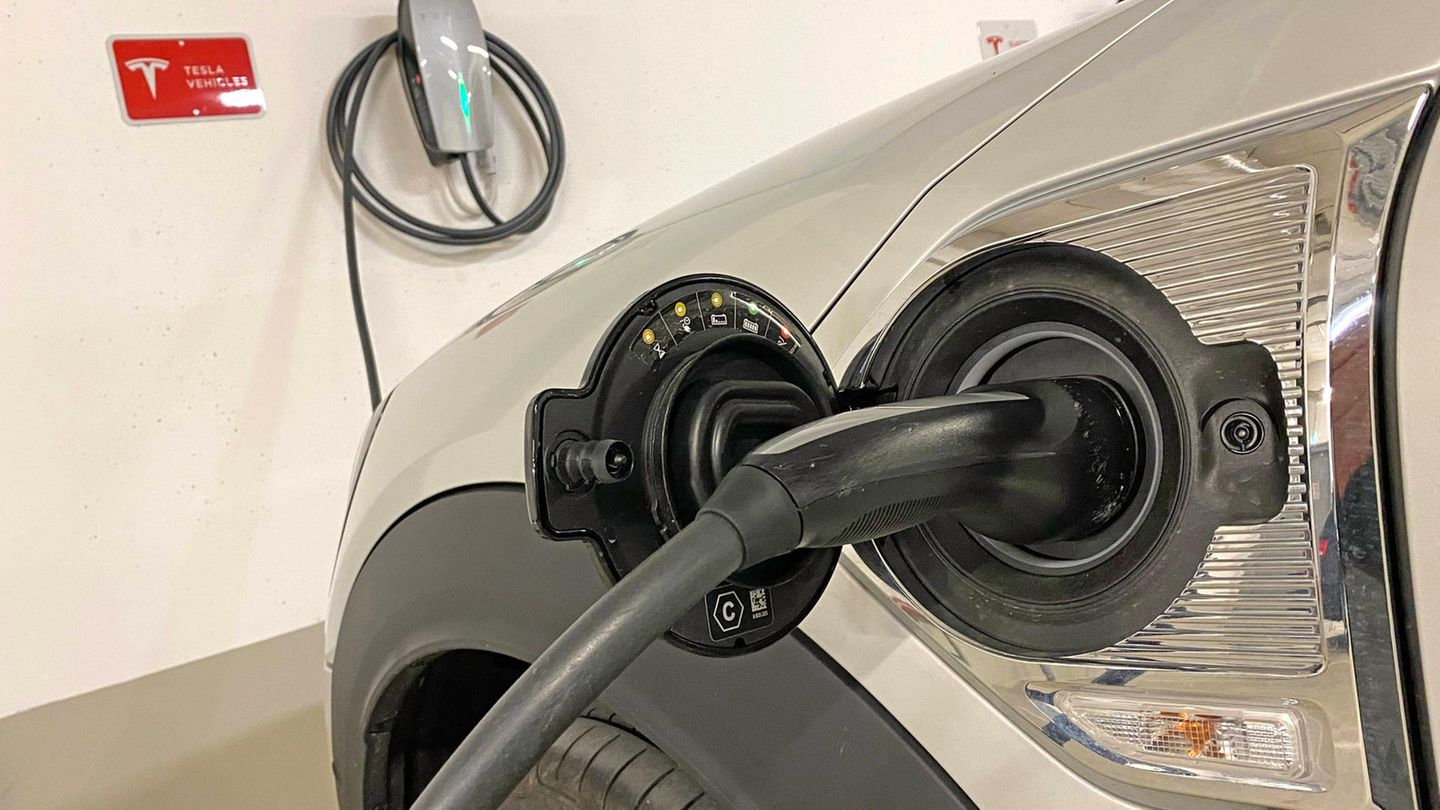Mehr als 300 Euro können Halterinnen und Halter von Elektrofahrzeugen im Rahmen der THG-Quote bereits für die eingesparten CO2-Emissionen erwarten. Nun kommt eine neue Einnahmequelle hinzu: Wer ein Elektroauto oder ein Plug-In-Hybrid sowie eine private Wallbox besitzt, der kann den gezapften Strom in den CO2-Handel bringen, wie "Heise" berichtet. Dafür muss man die geladene Strommenge in Kilowattstunden lediglich in einem Portal melden. Pro Kilowattstunde gibt es dann laut dem Medienbericht rund zehn Cent.
Derzeit ist dies demnach über die "ZusammenStromen GmbH" möglich. Denn die überträgt das Angebot nun auf Privatpersonen. Betreiber öffentlicher Ladestationen profitieren schon länger über den THG-Quotenhandel von der Geldzahlung.
Wallbox muss als öffentlich deklariert werden
Der kleine Hacken dabei: Die eigene Wallbox muss als öffentlich deklariert werden. Luca Schmadalla, CEO bei ZusammenStromen ordnet gegenüber "Heise" allerdings ein: "Eine Wallbox öffentlich machen heißt nicht, dass sie in Onlineverzeichnissen zu finden ist." Es sei den Nutzerinnen und Nutzern selbst überlassen, ob und wem diese Information zugänglich gemacht werde, so Schmadalla.
Die Anforderungen der Ladesäulenverordnung (LSV) müssen zwar erfüllt sein. Doch dies ist bereits der Fall, wenn man die Wallbox theoretisch für eine Minute pro Tag öffentlich zugänglich macht. In der Praxis muss die private Ladestelle allerdings nicht für andere erreichbar sein.
So soll man bei einem Stromverbrauch von beispielsweise 20 kWh über 15.000 Kilometer im Jahr an der heimischen Wallbox etwa 300 Euro erhalten können – angesichts der hohen Strompreise sicherlich eine lukrative zusätzliche Einnahmequelle. Ob der Strom aus der Solaranlage oder dem öffentlichen Stromnetz stammt, spielt dabei keine Rolle. Auch prüft das Umweltbundesamt als zuständige Behörde die angegebene Strommenge grundsätzlich nicht nach. Im Verdachtsfall kann es aber zu Stichproben kommen.
Weitere Anbieter dürften folgen, wie es auch schon beim Handel mit CO2-Zertifikaten der Fall ist. Neben Privatpersonen können nun auch Firmen den THG-Quotenhandel für ihre Ladestellen nutzen.
Quellen: Heise
Lesen Sie auch: