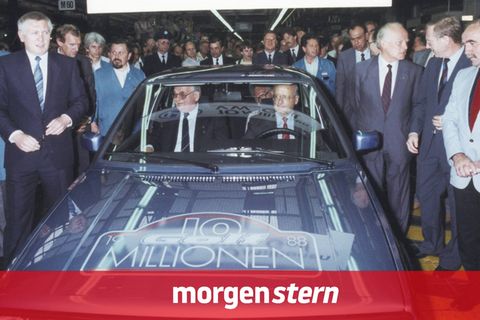Am 21. Juli dieses Jahres hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) die Förderungen für private Wallboxen um weitere 300 Millionen Euro aufgestockt. "Laden muss überall und jederzeit möglich sein. Eine flächendeckende und nutzerfreundliche Ladeinfrastruktur ist Voraussetzung dafür, dass mehr Menschen auf klimafreundliche E-Autos umsteigen", sagt Minister Andreas Scheuer. Also können Bundesbürger, die ihr Elektroauto an einer heimischen Wallbox laden wollen, sich pro Ladepunkt mit 900 Euro vom Staat unterstützen lassen. Die Förderung wird nach wie vor über die KfW-Bank abgewickelt.
Allerdings sind laut BMVI folgende Bedingungen zu erfüllen: Die Ladestation muss über eine Normalladeleistung von 11 kW verfügen, der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien kommen und die Ladestation intelligent und steuerbar sein (mit Blick auf die Netzdienlichkeit). Gerade den letzten Punkt sollten Interessenten im Blick behalten, denn das bedeutet letztendlich, dass der Ladestrom unter Umständen gedrosselt werden kann. Bevor man die Installation einer Wallbox angeht, empfiehlt es sich, sich mit der heimischen Stadt beziehungsweise Kommune in Verbindung setzen oder auf der Homepage nachschauen, welche weiteren Bestimmungen eventuell noch gelten.
E-Autos zu Hause laden: Checklist für Wallboxen
Bevor man sich für eine Wallbox entscheidet, sollte man sich eine kleine Checkliste zusammenstellen, damit die heimische Stromtankstelle auch möglichst effizient ihr Werk verrichten kann. Ganz wichtig ist der Onboardlader des Elektroautos, wenn der lediglich eine Ladeleistung von 3,6 kW schafft, dann dauert das Füllen der Stromspeicher deutlich länger. Wie lange, das kann jeder anhand der einfachen Formel "Ladezeit ist Batteriekapazität geteilt durch Ladeleistung" ausrechnen.
Die Wallbox selbst sollte möglichst intelligent mit dem Auto und dem Stromnetz kommunizieren können. Auch eine App, mit der man den Ladevorgang bequem aus der Ferne überwachen beziehungsweise steuern kann, macht das Stromtanken leichter. Der Königsweg ist die eigene Fotovoltaikanlage, die das Elektroauto via der Wallbox mit selbst produzierten Strom füllt. Dass die Installation der Wallbox von einem Fachmann durchgeführt werden sollte und der eine Markenwallbox verwenden sollte, liegt auf der Hand. Der prüft auch, welchen Stromanschluss man braucht. Soll die Ladeleistung 11 kW oder gar 22 kW betragen, ergibt ein dreiphasiger Drehstromanschluss mit 400 Volt Spannung und eine Stromstärke von 16 beziehungsweise. 32 Ampere Sinn.
Die Frage lautet nun, welche Wallbox man verwenden sollte. Dass nur ein förderwürdiges Modell finanzielle Vorteile bringt, liegt auf der Hand. Außerdem muss man entscheiden, wie viel Ladepunkte nötig sind. Wallboxen für ein Elektroauto kosten rund 1.000 Euro, sollen zwei Stromer aufgeladen werden, verdoppelt sich der Preis. Einige Hersteller bieten eigene Wallboxen an, die meistens in Kooperation mit Wallbox-Herstellern hergestellt werden. Oft bieten Autobauer wie VW bereits beim Kauf eines BEVs ein Paket an, das die Installation der Stromtankstelle beinhaltet. Allerdings sollte man immer die Förderung im Blick behalten und beispielsweise bei VW zum ID.Charger Connect greifen.
Verschiedene Wallboxen im Test
Grundsätzlich gut aufgestellt ist man mit der Webasto Pure-Wallbox, die für weniger als 700 Euro zu haben ist. Allerdings steht die fehlende Internetfähigkeit einer Förderung im Wege. Wer eine förderwürdige Webasto-Wallbox haben will, sollte sich die Webasto Live genauer anschauen, die aber mit einem Preis von rund 1.400 Euro deutlich teurer ist. Eine Alternative für die, die ihre eigene Stromzapfsäule überall mithinnehmen wollen, sind portable Lösungen, wie der Juice Booster 2, der bis 22 kW laden kann und aktuell für rund 1.000 Euro zu haben ist. Allerdings nimmt diese portable Wallbox einiges an Platz weg und man muss den passenden Stromanschluss finden. Beim Verwenden einer solchen mobilen Ladelösung muss man auch immer im Kopf haben, dass Langfinger ein Auge auf eine solche mobile Wallbox werfen könnten. Damit das Gerät gesichert ist, bietet Juice Booster eine Variante mit Schließbügel und Schlüsselschloss.
Beim ADAC-Test holte sich die Wallbox Kostad TX-1000 den Gesamtsieg, indem sie durch eine kompakte Bauweise eine maximale Ladegeschwindigkeit von 22 kW und eine leichte Bedienbarkeit überzeugte. Allerdings hat der Hersteller Kostad mit der Unity20 Wallbox bereits einen Nachfolger auf den Markt gebracht, der ebenfalls überzeugt. Eine Alternative ist die Heidelberg Wallbox Energy Control, die mit maximal 11 kW die Stromspeicher befüllt. Auch hier muss man beim Erwerb genau hinschauen, da auch Heidelberg Wallbox Modelle anbietet, die nicht gefördert werden. Hier ist der Namenszusatz "Energy Control" entscheidend. Mit Preisen von gut 800 Euro sind die Heidelberg Wallboxen einen Blick wert.

Der Wallbox-Hersteller ABL arbeitet unter anderem mit Mercedes und Audi zusammen, außerdem ist das fränkische Unternehmen beim Aufbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur in München und Nürnberg aktiv. Dementsprechend ausgereift sind auch die Modelle. Laut ABL ist die Wallbox eMH1 anschlussfertig vorinstalliert und es wird kein zusätzlicher Fehlerstromschutz benötigt, was sich positiv auf die Kosten auswirkt.