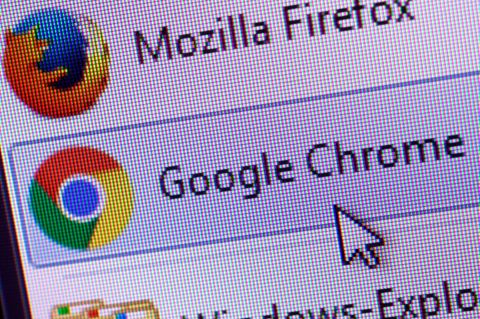Herr Lilly, seit diesem Jahr sind Sie Vorsitzender der Mozilla Corporation, der kommerziellen Tochter der gemeinnützigen Mozilla-Stiftung. Ihre Vorgängerin Mitchell Baker sagte, Sie seien genau der Richtige, um "das Reifen von Mozilla voranzutreiben". Was meint sie damit?
Wüsste ich auch gern. (lacht) Na ja, wir sind jetzt zehn Jahre alt. Als das Mozilla-Projekt 1998 begann, wusste niemand so recht, wohin das führen würde. Netscape und Microsoft haben den Browsermarkt beherrscht. Mozilla hat mit ein paar Mitarbeitern angefangen - inzwischen haben wir zweihundert Angestellte. Und Tausende von Ehrenamtlichen auf der ganzen Welt, die uns unterstützen. Firefox hat weltweit 200 Millionen Nutzer, es gibt ihn in sechzig länderspezifischen Versionen. Daneben bieten wir das E-Mail-Programm Thunderbird an und zig andere Produkte.
Wie behalten Sie als Leiter eines riesigen, dezentralen Open-Source-Projektes wie Mozilla überhaupt den Überblick?
Das ist manchmal schwierig - aber zum Glück auch nicht immer nötig. Denn wir funktionieren nicht wie ein traditionelles hierarchisches Unternehmen. Entscheidungen werden ziemlich direkt an der Front getroffen, von denjenigen etwa, die den Grafik- oder den Sicherheitscode schreiben und sich auf diesem Gebiet gut auskennen. Wir versuchen, Entscheidungsfindungen so weit wie möglich zu dezentralisieren.
Mozilla funktioniert also basisdemokratisch?
Nein, das nicht. Es gibt schon Leute mit klarer Entscheidungsbefugnis in ihrem jeweiligen Kompetenzgebiet. Mozilla ist nicht demokratisch. Aber partizipatorisch. Die Entscheider bemühen sich um das Feedback und die Mitarbeit aller. Man muss die Leistung und den Beitrag der anderen würdigen. Sonst bricht die Community schnell auseinander.
Warum arbeiten eigentlich Tausende ehrenamtlich für ein Projekt wie Firefox, an dem Mozilla Millionen verdient?
Geld ist doch nicht der einzige Grund für Menschen, etwas zu tun! Teil einer großen Sache zu sein, Mitbestimmung, Selbstverwirklichung, die Möglichkeit, wirklich etwas bewegen zu können - all das ermöglichen wir den Menschen. Und ja, wir verdienen Geld damit. Aber das dient der Allgemeinheit. Alles, was wir verdienen, stecken wir in die Entwicklung neuer Produkte.
Sie beschwören immer wieder den Mozilla-Leitspruch: "Das Internet soll für alle besser werden!" Was heißt das konkret?
Es soll offener, spannender, innovativer werden. Vor fünf Jahren hatte Microsofts Internet Explorer einen Marktanteil von 95 Prozent. Das war ungut, für alle. Es gab einen Innovationsstau. Das Internet befand sich quasi in einer Todesstarre. Heute ist das Netz ganz gut in Form, würde ich sagen. Allerdings gibt es mancherorts schon noch einiges zu tun. Im Videobereich etwa ist das Netz noch lange nicht so offen, wie es sein sollte. Die nötigen Programme sind zumeist im Besitz von Konzernen wie Adobe oder Microsoft.
Zur Person
Seit diesem Jahr ist John Lilly, 37, Geschäftsführer der Mozilla Corporation - der 2005 gegründeten, geschäftstüchtigen Tochtergesellschaft der gemeinnützigen Mozilla-Stiftung. Die Organisation möchte "das Internet als Ort der Innovation und des offenen Austauschs beibehalten" und stellt dafür kostenlose Open-Source-Software zur Verfügung, die vor allem durch die ehrenamtliche Arbeit tausender Unterstützer entsteht. Die bekanntesten Mozilla-Produkte sind der Internetbrowser Firefox, der inzwischen weltweit einen Marktanteil von rund 20 Prozent erzielt (in Deutschland: knapp 30 Prozent), und das E-Mail-Programm Thunderbird. Bevor Lilly 2005 zu Mozilla kam, war er Technischer Leiter des von ihm mitbegründeten Software-Unternehmens Reactivity. Davor entwickelte er bei Apple Anwendungen für das Internet.
In diesem Jahr ist Firefox 3 erschienen und hat einen Download-Weltrekord erzielt. Womit soll die Internetwelt im nächsten Jahr gerettet werden?
Anfang 2009, wahrscheinlich schon im Januar oder Februar, wird Firefox 3.1 erscheinen. Damit wird Internetsurfen noch einmal schneller. Es wird einige schöne neue Features geben, wie "privates Surfen". Darüber hinaus kommt gerade eine Alpha-Version unseres ersten Handy-Browsers heraus. Gerade beim mobilen Internet gibt es noch viel zu tun.
Google, bislang Ihr wichtigster Geschäftspartner, hat vor kurzem seinen eigenen Open-Source-Browser Chrome auf den Markt gebracht - eine direkte Konkurrenz zu Firefox. Wie fühlt man sich da?
Zunächst einmal dürfen wir unser eigentliches Ziel nicht aus dem Blick verlieren: ein möglichst offenes Netz. Mehr offene Browser zu haben, ist also etwas Gutes. Wettbewerb ist ebenfalls etwas Gutes. Was nun Mozilla angeht: Möglicherweise wäre es für uns einfacher, wenn Google das mit Chrome nicht gemacht hätte. Andererseits ist es ja nicht so, dass wir noch nie im Wettbewerb mit großen Konzernen gestanden hätten. Denken Sie nur an Microsoft.
Womöglich war Microsoft aber ein dankbarerer Gegner.
Wie kommen Sie denn darauf? Auf jedem einzelnen Computer, der verkauft wurde, war damals Microsofts Internet Explorer vorinstalliert! Das ist doch alles andere als ein dankbarer Gegner.
Die Dinge lagen aber moralisch einfacher. Microsoft war - und ist - für viele in der Internetgemeinde ein willkommenes Feindbild.
Ich würde die Sache nicht zu moralisch betrachten. Aber es stimmt: Es gibt eine verbreitete Abneigung gegenüber Microsoft, die uns sehr geholfen hat. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Situation mit Google.
Waren Sie froh, dass der Marktanteil von Chrome seit seiner Veröffentlichung unter der 1-Prozent-Marke geblieben ist?
Ich empfinde darüber keine Schadenfreude oder so etwas. Es wäre voreilig, Chrome jetzt schon abzuschreiben. Außerdem trägt Google ja dazu bei, das Netz weiter zu öffnen. Da gibt es noch viel zu tun: Drei Viertel der Internetnutzer verwenden noch immer den Browser, den sie mit ihrem Computer geliefert bekommen. Denen muss man bewusst machen, dass der Browser gleichsam die Brille ist, durch die man das Internet betrachtet - von dieser Brille hängt sehr viel ab. Man muss die Menschen dafür sensibilisieren, muss sie wachrütteln. Ich denke, in dieser Hinsicht wollen Google und wir dasselbe.
Laut Ihren aktuellen Geschäftszahlen stammen knapp 90 Prozent des Mozilla-Umsatzes aus der Kooperation mit Google. Warum arbeiten Sie derart eng mit einem Konzern zusammen, der das Internet dominiert wie kein anderer? Schließlich war Mozilla einst angetreten, gegen Microsofts marktbeherrschende Stellung und für die Vielfalt im Netz zu kämpfen.
Na ja, ich würde sagen, die Vorherrschaft im Suchmaschinenbereich ist etwas anderes als die Marktbeherrschung bei Betriebssystemen und der Anwendersoftware. Allerdings sind Suchmaschinen inzwischen sehr wichtig geworden, das stimmt. Es wird wohl alles davon abhängen, ob Google seine Rolle gut und verantwortungsbewusst spielt. Bisher haben sie das meiner Meinung nach getan. Aber wir sehen uns natürlich nach alternativen Einnahmequellen um.
Womöglich werden Sie sich eines Tages mit Microsoft gegen Google verbünden müssen.
Ist schon möglich, wer weiß. Wir arbeiten auch jetzt schon hin und wieder mit Microsoft zusammen. Wir sprechen über Webstandards, über Grafiknormen ... Aber zu sagen, dass wir uns mit ihnen gegen Google verbünden, wäre zum jetzigen Zeitpunkt noch etwas weit hergeholt.
Sie klingen sehr enthusiastisch, wenn Sie über das Internet und seine Segnungen sprechen. Und Sie machen von ihnen regen Gebrauch: Sie bloggen. Sie stellen Ihre Reisefotos online. Sie teilen der Welt via Twitter in Echtzeit mit, wenn Sie in Berlin Kürbissuppe essen. Gibt es etwas, das Sie am Internet kritisch sehen?
Oh, es gibt einiges an dieser Entwicklung, was wir noch gar nicht richtig beurteilen können. Zum Beispiel, welche Auswirkungen es für uns hat, jederzeit mit allem und jedem verbunden zu sein. An mir selbst bemerke ich ein paar kleine Suchterscheinungen. Ständig greife ich nach meinem Handy, checke meine E-Mails, verschicke immer und überall Textmitteilungen. Da ist so eine gewisse Nervosität, eine innere Unruhe. Wohin unser Leben mit dem Internet führt, wird sich zeigen. Wir wissen es nicht. Wir müssen es ausprobieren. Mein Sohn zum Beispiel, der ist jetzt drei Jahre alt. Er hat dank meiner Frau und mir einen Blog, seit er auf der Welt ist.
Na, das ist ja großartig ...
Es ist tatsächlich großartig, weil meine Eltern auf diese Weise zusehen können, wie ihr Enkelsohn aufwächst. Ich weiß natürlich nicht, ob er selbst in zehn Jahren denken wird, dass das so eine tolle Sache ist.