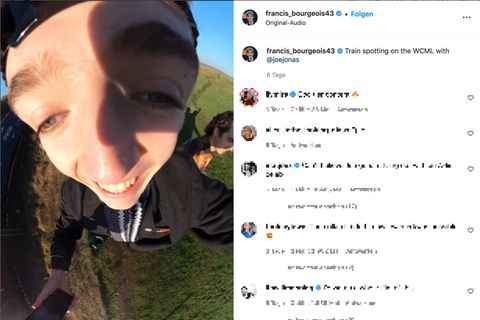Herr Bode, Verbraucherminister Horst Seehofer stellt einen Aktionsplan gegen Fettleibigkeit vor, den stern.de vorab veröffentlicht hat. Was halten Sie von den Vorschlägen?
Bei solchen Aktionsplänen kommt es darauf an, die Ursachen für das Problem zu ergründen und zu überlegen: Wo kann die Politik eingreifen und wo nicht? Doch was ist bisher in der Politik gelaufen? Seehofers Vorgängerin Renate Künast hat die "Plattform für Ernährung und Bewegung" gegründet. Da sind einige Verbände drin, die Bundesregierung und vor allem die Nahrungsmittelindustrie sind bestens vertreten. Ein Vorstandvorsitzender eines Nahrungsmittelkonzerns hat mir mal gesagt: "Wir gehen da mit rein, damit nichts anbrennt" - ein Unding! Doch damit macht die Regierung die Konsensbildung mit der Industrie zum Prinzip ihrer Politik. Da kann man sich schon fragen: Wird noch das Gemeinwohl vertreten - oder wird die Regierung zur Erfüllungsgehilfin der Nahrungsmittelindustrie?
Was läuft da falsch?
Die Politik legt sich nicht mit der Industrie an. Deshalb weicht die Politik gern auf unverfängliche Felder aus, auf denen man sie nur schwer zur Rechenschaft ziehen kann. Beim Thema Fettleibigkeit wird dann gern davon geredet, dass jetzt die Schulen mehr machen müssten, dass die Menschen sich mehr bewegen sollten, mehr zu Hause essen. Klingt alles wunderbar - aber wo sind die Konsequenzen?
Warum scheut die Politik den Konflikt?
Die Nahrungsmittelkonzerne sind eng verbandelt mit der Agrarindustrie, diese wiederum mit der chemischen Industrie. Und diese ganze Lobby hat dazu noch ein eigenes Ministerium in Berlin, das Landwirtschaftsministerium. Dass dieses formal auch für "Verbraucherschutz" zuständig ist, davon merken die Verbraucher nicht viel. Die Landwirte sind der einzige Berufsstand, der ein eigenes Ministerium hat. Ein Anachronismus! Und Horst Seehofer verkündet, die Interessen der Bauern und Verbraucher seien identisch. Eine Verdummung der Verbraucher!
Mit der Folge, dass wir mit Fertigkost abgespeist werden, die dick und fett macht?
Eine Fertigpizza ist ja nichts Schlechtes an sich. In unserem Leben ist man manchmal auf Fast Food und Schnellküche angewiesen. Aber auch bei dieser Art von Ernährung gibt es gute und schlechte Ware. Grundsätzlich sollte aber man mit den sozialen Ursachen der Fettleibigkeit anfangen, nämlich mit der Einkommenssituation und dem Bildungsstand der Menschen. Arme Menschen, das betrifft etwa 20 Prozent der Haushalte, essen zu viel Fett und zu viel Zucker. Sie haben einfach nicht genug Geld, sich Obst und Gemüse zu leisten, um sich ausgewogen zu ernähren. Dick sein ist auch ein Zeichen von Armut und ein Zeichen von mangelnder Bildung. Hier könnte der Staat eingreifen. Er könnte aber auch dafür sorgen, dass sich qualitativ gute Nahrungsmittel am Markt besser behaupten können. Doch dazu müsste er sich wiederum mit der Industrie anlegen. Zum Beispiel, um Warnhinweise für besonders zucker- und fetthaltige Nahrungsmittel durchzusetzen. Wenn Qualitätsware nicht einen aussichtslosen Kampf gegen Massenware führen müsste, die ungestraft Qualitätsversprechen abliefert, die sie nicht hält, wären mehr preiswertere und gesündere Nahrungsmittel auf den Markt.
Aber jede Industrienahrung macht dick.
Nein, verarbeitete Nahrungsmittel müssen nicht unbedingt dick machen. Aber nehmen sie zum Beispiel die Softdrinks, die für Kinder wegen des hohen Zuckergehalts ein Problem sind. Das sind die eigentlichen Kalorienbomben, nicht der Hamburger dazu. Dies müsste viel deutlicher werden. Überhaupt Zucker: Der kommt in der Nahrungsindustrie nicht vor - zumindest offiziell nicht. Ein Beispiel: Der Erdbeer-Milchjoghurt "Biene Maja" von Bauer. Da steht auf der Packung, er enthalte 16,4 Gramm Kohlenhydrate. Dies heißt aber nichts anderes als Zucker. Umgerechnet sind das 55 Stück Würfelzucker pro Liter. Ein Liter Cola mit einem Gehalt von 35 Stück Würfelzucker ist dagegen das reinste Diätgetränk. Die Industrie versteckt Zucker hinter harmlos klingenden Bezeichnungen wie "Kohlenhydrate" oder so einen Quatsch wie "Fruchtzucker aus der Natur". Aber Zucker bleibt Zucker. Überhaupt ist oft vieles nicht gesund, was als "Frucht" oder "gesunde Früchte" daherkommt. Von Schwartau gibt es etwa die "tägliche Portion Obst in einer Flasche", "ohne Zuckerzusatz, knackige Obststoffe" - sehr beliebt. Das ist aber nichts anderes als Wasser mit Fruchtsaftkonzentrat plus "natürliches Aroma", also Aromen aus Holzpilzen, nicht etwa aus echten Früchten.
Gibt es auch positive Beispiele für Industrienahrung?
Die gibt es, aber sehr wenige. Zum Beispiel Tiefkühlkost von "Frosta". Die verwenden tatsächlich keine Zusatzstoffe, also keine Farbstoffe oder Geschmacksverstärker. Wie schwer es aber so ein Anbieter hat, zeigt eine neue Tütensuppe von Maggi, die sich "Natur Pur mit 100 Prozent natürlichen Zutaten" nennt und angibt: "ohne Zusatzstoffe". Das stimmt aber nicht, denn in der Tüte ist tatsächlich Hefeextrakt drin, ein glutamathaltiger Geschmacksverstärker. Trotzdem kann Maggi behaupten: "ohne Zusatzstoffe", weil Hefeextrakt nicht in der Zusatzstoff-Zulassungsverordnung steht.
Das heißt, die anzugebenden Inhaltsstoffe sind vor allem eine Frage der Definition?
Man kann Qualität nicht anhand von Marketingbegriffen wie "frisch", "gesund", "natürlich" unterscheiden, weil sie nicht geschützt sind. Nehmen wir den "Fruchttiger", ein so genannter "gesunder Durstlöscher" von Pepsi. Da ist etwa E 330 drin, also Zitronensäure - eine Säure, die auch als Abflussreiniger eingesetzt wird. Auf Abflussreinigern mit Zitronensäure steht wenigstens ein Warnhinweis für Kinder. Zitronensäure greift Zähne stark an und kann auch die Aufnahme von Schwermetallen begünstigen.
Aber es gibt doch eine Reihe von Produkten, deren Qualität unbestritten ist.
Sicher, aber wenn die Nahrungsmittelhersteller mal echte Qualität anbieten, etwa einen echten Saft mit Früchten aus der Region, dann haben sie keine Chance. Denn solche Qualität kann sich nicht von der Masse der anderen Anbieter abheben. Das würde nur funktionieren, wenn gesetzlich festgelegt wird, welche Kriterien für was stehen.
Ein Fall für Herrn Seehofer.
Der Markt besteht durchgehend aus Irreführung und Täuschung der Verbraucher. Warum müssen die Anbieter nicht nachweisen, was sie behaupten? Ein Beispiel: das Wort "artgerecht". Auf vielen Milchpackungen steht, die Milchkühe seien artgerecht gehalten. Bei Bio sind die Standards artgerechter Tierhaltung gesetzlich festgelegt. Aber auch auf einer "Landliebe-Milch" des Konzerns Campina steht das drauf. Nur kann der Kunde nicht überprüfen, ob das stimmt. Und dass die Milchkühe, die die "Landliebe-Milch" liefern, mit gentechnisch verändertem Soja gefüttert werden, erfahren die Verbraucher ohnehin nicht. Hier muss der Gesetzgeber intervenieren und klarstellen, welche Begriffe man verwenden und welche nicht. Und es wäre ja schon viel getan, wenn er wenigstens sagen würde: Mit diesen und diesen Begriffen dürft ihr nicht mehr werben.
Offenbar wissen viele Verbraucher zu wenig über Nahrung. Brauchen wir mehr Informationen?
Die Frage ist doch: Wird der Verbraucher nicht eher mit Informationen überschüttet, mit denen er nichts anfangen kann? In der Schweiz heißt Apfelsaft Apfelsaftkonzentrat. Da gibt es keine Fragen. Bei uns aber steht groß Apfelsaft drauf, auch wenn es nur Konzentrat ist. Oder warum können wir nicht die gesetzlich definierte Produktkategorie "zusatzstofffrei" einführen? Als Sammelbegriff für "ohne Farbstoffe, Konservierungsmittel, künstliche Aromen und Antioxidantien". Wir brauchen nicht mehr Informationen - wir müssen viele der falschen, überflüssigen und irreführenden Informationen beseitigen.
Müsste an Schulen Ernährungskunde unterrichtet werden?
Auf jeden Fall. Das Problem hat viele Ursachen und wir können nicht alles über die Verpackungskennzeichnung lösen. Auch wenn das schon viel bringen würde. Aber wir müssen uns klar werden: Was muten wir dem Verbraucher zu? Wenn da 30 E-Stoffe drauf stehen, da ist doch jeder überfordert. Wenn wir zunehmend Ganztagsschulen haben werden, muss das Wissen über Ernährung und Essen ein wichtiges Unterrichtsfach werden.