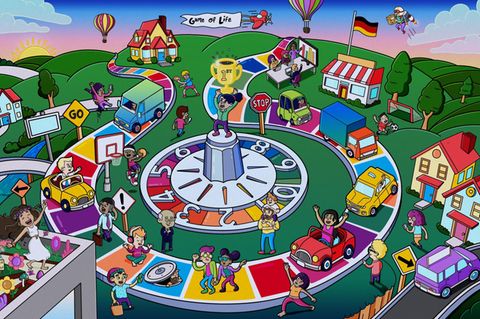Eine Fahrradstraße, durch die aber gar nicht mal so viele Radfahrer fahren wollen, ein Dachgarten, den die Bürger gar nicht betreten dürfen oder eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung für ein funktionsloses Bahn-Stellwerk: Jedes Jahr kritisiert der Steuerzahlerbund in seinem Schwarzbuch Fälle an, in denen Behörden aus Sicht des Verbands Steuergeld verschwendet haben. In diesem Jahr haben es elf Fälle aus dem Südwesten auf die Liste der Schildbürgerstreiche und Millionengräber des Verbands geschafft. Eine Auswahl:
Fahrradstraße ohne Radler
Weil sie den Radverkehr fördern wollte, richtete die Stadt Baden-Baden im vergangenen Frühjahr eine Fahrradstraße ein - inklusive neuen Markierungen, Schildern und kleineren Umbauten. Nicht einmal ein Jahr später dann die Rolle rückwärts: Die Fahrradstraße wird wieder rückabgewickelt - unter anderem, weil zu wenige Radler die Fahrradstraße nutzen.
Laut Steuerzahlerbund hatte die Stadt vorab keine Erhebungen durchgeführt, wie viele Radler die Straße eigentlich täglich nutzen. "Ohne dieses Versäumnis hätte man allerdings schon vor Projektbeginn erkennen können, dass der Umbau zur Fahrradstraße an dieser Stelle nicht sinnvoll ist", heißt es im Schwarzbuch. Damit hätte die Stadt nach Ansicht des Steuerzahlerbunds rund 115.000 Euro sparen können. Und das in Baden-Baden, das finanziell ohnehin klamm sei.
Die Stadt steht weiter zu der Maßnahme. Zwar habe die Einrichtung der Fahrradstraße nicht die erhoffte Akzeptanz erfahren, sie sei aber keineswegs vergeblich gewesen, sagte Bürgermeister Tobias Krammerbauer. "Der geschaffene Schutzstreifen besteht weiterhin und verbessert nach wie vor die Sicherheit für Radfahrende. Insofern sind die aufgewendeten Mittel sinnvoll investiert."
Viel Gerede um einen Tunnel - wenig Neuerungen
Ebenfalls um Radfahrer geht es bei einem Fall aus Stuttgart. Um den dortigen Flughafen zu queren und vom Stadtteil Plieningen ins benachbarte Filderstadt zu gelangen, müssen Autos, Radler und Fußgänger durch einen Tunnel. Autos haben je eine Spur in jede Richtung, Radler und Fußgänger nur einen Weg am Rand, der manchmal nicht breiter als ein Meter ist. Wie die Situation für Radler und Fußgänger besser werden könnte, wurde breit debattiert. Der Vorschlag, eine Spur für Autofahrer zu sperren, stieß auf wenig Gegenliebe, ein gesonderter Tunnel hätte rund 100 Millionen Euro gekostet. Am Ende blieb zunächst alles beim Alten - aber es wurden rund 264.000 Euro für Gutachten, Untersuchungen und Berater fällig. War das wirklich nötig, fragt der Steuerzahlerbund.

Wollen Sie nichts mehr vom stern verpassen?
Persönlich, kompetent und unterhaltsam: Chefredakteur Gregor Peter Schmitz sendet Ihnen jeden Mittwoch in einem kostenlosen Newsletter die wichtigsten Inhalte aus der stern-Redaktion und ordnet ein, worüber Deutschland spricht. Hier geht es zur Registrierung.
Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) spricht von einer preiswerten Zwischenlösung, die man gefunden habe. "Was an Untersuchungen notwendig war, wird auch in der Zukunft Bestand haben. Entscheidend ist, dass Menschen ohne Auto sich nicht durch einen viel zu engen Tunnelteil zwängen müssen, die Verkehrssicherheit gewährleistet bleibt und Autoverkehr zugleich nicht in Wohngebiete verdrängt wird – dafür braucht es Fachexpertise", sagte der Minister.
Viel Geld für vier Fledermäuse
Kopfschütteln löst beim Steuerzahlerbund auch die teure Umsiedlung von Fledermäusen in der Gemeinde Kirchberg an der Murr aus. Weil im Dach der alten Gemeindehalle zeitweise vier Zwergfledermäuse wohnten, musste die Gemeinde gut 40.000 Euro für deren Umsiedlung investieren. Doch damit nicht genug: Weil erst noch mehrmals nachgewiesen werden muss, dass die Tiere ihre Ausweichquartiere auch annehmen, darf die Halle frühestens im Winter 2027/2028 abgerissen werden. Der Fall zeige, dass der deutsche Artenschutz in der Praxis teils absurde Auswirkungen habe und es dringend Regelungen brauche, die das Verhältnismäßigkeitsprinzip berücksichtigten, mahnt der Steuerzahlerbund.
Auch der Bürgermeister der Gemeinde sieht das so. Es sei völlig unstrittig, dass man für wegfallende Quartiere neue Quartiere schaffe. Infrage stelle er aber das Monitoring. "Wieso sind wir verpflichtet nachzuweisen, ob Ausgleichsmaßnahmen, die von Fachleuten vorgeschlagen und denen die Fachbehörde zugestimmt hat, von den Tieren, in diesem Fall den Fledermäusen, angenommen werden", sagte Frank Hornek (parteilos).
Aufpasser für ein marodes Bahn-Stellwerk
Es war ein Bild, das man wohl nur selten sieht: Im Mai wurde in Calw ein altes Stellwerksgebäude der Bahn mit einem Kran durch die Luft gehoben und über die Gleise versetzt. Ein junger Mann will das denkmalgeschützte Gebäude nun restaurieren und dann zur Besichtigung öffnen. Was aber davor geschah, ordnet der Steuerzahlerbund in seinem Schwarzbuch dem Kapitel "Richtig skurril" zu. Weil das Stellwerk aus dem späten 19. Jahrhundert als einsturzgefährdet galt, habe es die Bahn rund 80 Tage lang rund um die Uhr durch einen Sicherheitsdienst überwachsen lassen - weil befürchtet worden sei, dass Teile des Gebäudes auf die Gleise fallen könnten. Kostenpunkt laut Medien: Rund 1.000 Euro pro Tag. Diese hätten verhindert werden können, wenn die Bahn zügiger gehandelt hätte, kritisiert der Steuerzahlerbund.
Ein Bahnsprecher teilte mit, dass der bauliche Zustand des Stellwerks die Überwachung erforderlich gemacht habe. In der Zeit der Bewachung habe man dann klären müssen, was mit dem Stellwerk weiter geschehe.
Garten auf Parkhausdach - aber ohne Besucher
Für rund 10.000 Euro ließ die Stadt Stuttgart im vergangenen Jahr 30 mediterrane Pflanzen auf das oberste Deck eines Parkhauses bringen, um dort einen kleinen Park zu schaffen, berichtet der Bund der Steuerzahler. Im Herbst wurden die Pflanzen dann für weitere 5.000 Euro wieder abtransportiert. Kurios: In der Zwischenzeit hatte die Pflanzen wohl niemand zu Gesicht bekommen denn nach Angaben der Stadt habe aus baurechtlichen Gründen niemand das Parkdeck mit den Kübeln betreten dürfen. Darauf habe Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) auch schon vor dem Hinaufbringen der Pflanzen hingewiesen, teilte die Stadt dem Steuerzahlerbund mit. Trotzdem sei die Mehrheit des Ältestenrats der Meinung gewesen, dass man die Pflanzen dennoch aufs Dach bringen solle. Eine Anfrage an die Stadt Stuttgart blieb zunächst unbeantwortet.
Wird die Opernsanierung zum Milliardengrab?
Schon bevor die Sanierung der maroden Stuttgarter Oper überhaupt begonnen hat, warnt der Steuerzahlerbund, dass diese sich zu einem Fass ohne Boden entwickeln könnte. Ende 2024 war bekanntgeworden, dass sich die Sanierung des heruntergewirtschafteten Opernhauses deutlich verzögern wird. Die Kosten für das ganze Projekt teilen sich Stadt und Land. Bisher wird für die Sanierung rund eine Milliarde Euro veranschlagt - das ist allerdings eine Berechnung aus dem Jahr 2019. Sollten die Kosten weiter steigen, plädiert der Steuerzahlerbund dafür, zu prüfen, ob eine umfassende Sanierung überhaupt realisierbar sei. Im Zweifel solle die Reißleine gezogen und das Projekt neu und kleiner geplant werden, mahnt der Verband.
Das Wissenschaftsministerium teilte mit, dass die Sanierung aus Gründen des Arbeitsschutzes und des Brandschutzes alternativlos sei. Weil das Opernhaus während der Sanierung nicht bespielt werden könne, müsse eine Ausweichstätte errichtet werden, teilte ein Sprecher mit. "Für das Interim gibt es noch keine Kostenschätzung, aber um die Kosten möglichst gering zu halten, wird nun nach weiteren Einsparpotenzialen gesucht, um den Baukörper weiter zu reduzieren."