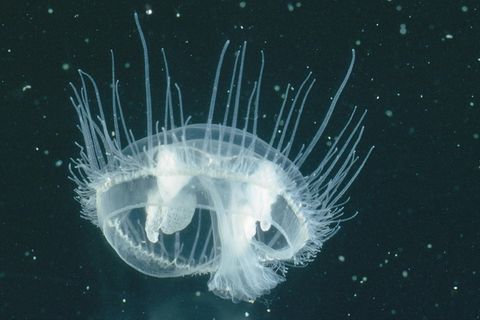Die Qualität deutscher Badestellen ist grundsätzlich gut: "Von den rund 2300 Badegewässern erfüllen fast 98 Prozent die vorgeschriebenen Qualitätsanforderungen", erklärt Regine Szewzyk, Fachgebietsleiterin des Bereichs Mikrobiologische Risiken am Umweltbundesamt. "90 Prozent haben sogar eine sehr gute Qualität."
Die Wasserqualität wird anhand der Konzentration zweier Darmbakterien bestimmt: E. coli-Bakterien und Darm-Enterokokken. Dabei handelt es sich um sogenannte Indikatorbakterien: Sie zeigen an, ob Fäkalien in das Gewässer gelangt sind und damit unter Umständen auch Krankheitserreger. Keime können etwa von landwirtschaftlichen Flächen ins Wasser gespült werden.
Obwohl von den meisten Badegewässern keine Gefahr ausgeht, können einzelne Seen und Flüsse mit Erregern belastet sein: "In Badegewässern führen vermutlich vor allem Viren und Parasiten zu Erkrankungen, weil sie schon in geringen Konzentrationen infektiös wirken", erklärt Expertin Szewzyk. Die unangenehmen Folgen: Hautausschläge, Übelkeit und Durchfall. Bakterien lösen dagegen erst in sehr viel höheren Konzentrationen Infektionen aus.
Doch woran erkennen Badende, wenn ein See belastet ist? Und wann sollte man auf keinen Fall schwimmen gehen? Sechs Tipps, mit denen sich das Infektionsrisiko senken lässt.
Tipp 1: Gewässer, die sauber scheinen, müssen nicht sauber sein
Das Wasser scheint klar, doch für Gewässer gilt: Badende sollten sich vom schönen Schein nicht blenden lassen. Auch klare Gewässer können mit Krankheitserregern belastet sein. "Verunreinigungen mit Fäkalien sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen", erklärt Regine Szewzyk. Wer in verseuchten Seen schwimmen geht, riskiert etwa Durchfallerkrankungen.
Die Expertin rät, sich vorab im Internet nach der aktuellen Wasserqualität des Badegewässers zu erkundigen. Das geht beispielsweise auf der Seite des Umweltbundesamtes mit einer interaktiven Karte, die auf die Seiten der einzelnen Bundesländer verweist. Dort erhalten Badende detaillierte Informationen zur Wasserqualität von Seen und Flüssen. Grundsätzlich gilt: "In Badegewässern mit 'sehr guter' Qualität ist das Infektionsrisiko am geringsten."
Tipp 2: Flüsse meiden – vor allem nach Regen
Flüsse können sich nach Starkregen zu wahren Keimschleudern entwickeln: Zum einen wäscht der Regen die Gülle von landwirtschaftlichen Flächen und spült sie in die Gewässer. Hinzu kommen meist Verschmutzungen aus der Kanalisation: Fällt in kurzer Zeit viel Regen, ist das Abwassersystem überfordert. Dann kann unzureichend geklärtes Abwasser in die Flüsse gelangen.
Auch wenn örtlich kein Regen gefallen ist, können Flüsse Krankheitserreger mit sich führen – nämlich dann, wenn es weiter flussaufwärts geregnet hat. Das Wasser kann die Erreger über etliche Kilometer mit sich spülen. Regine Szewzyk rät daher grundsätzlich vom Baden in Flüssen ab: "Flüsse, die kein offizielles Badegewässer sind, sollte man meiden." Hinzu kämen weitere Risiken, wie etwa starke Strömungen oder Schiffverkehr. Badeverbote und Hinweisschilder sollten unbedingt beachtet werden.
Tipp 3: Gewässer mit vielen Enten meiden
Wasservögel wie Enten und Gänse koten in das Wasser und verschmutzen es mit Bakterien, die beim Menschen zu Durchfallerkrankungen führen können. Insbesondere Seen, auf denen sich viele Vögel aufhalten, sollten gemieden werden, rät die Mikrobiologin.
Enten können auch dazu beitragen, dass sich sogenannte Zerkarien im See entwickeln: Dabei handelt es sich um die Larven von Saugwürmern. Sie können sich in die Haut von Badenden bohren und lokalen Juckreiz oder Quaddeln auslösen. Abgesehen davon sind Zerkarien jedoch harmlos. Sie sterben in der Haut von Menschen, und auch die Hautreaktion klingt im Laufe von einigen Tagen von selbst wieder ab.
Die Expertin empfiehlt auch, sich wenn möglich direkt nach dem Baden zu duschen und danach kräftig abzureiben. So werden unter Umständen Zerkarien entfernt, die noch nicht in die Haut eingedrungen sind.
Wasservögel sollten nicht gefüttert werden, rät Mikrobiologin Szewzyk. "Dadurch werden noch mehr Tiere angelockt und so langfristig die Qualität des Badegewässers verschlechtert."
Tipp 4: Vorsicht vor verfärbtem Wasser
Sind Gewässer blau-grün und trüb verfärbt, ist das ein Hinweis auf eine Massenentwicklung von sogenannten Cyanobakterien, umgangssprachlich auch Blaualgen genannt. Das Phänomen ist daher auch unter dem Namen "Algenblüte" bekannt.
Cyanobakterien lösen Hautreaktionen, Übelkeit und Durchfallerkrankungen aus. "Es gibt auch Hinweise, dass sie leberschädigend sind", sagt die Expertin des Umweltbundesamtes. Belastete Gewässer sollten daher unbedingt gemieden werden. Kinder sollten vom Ufer ferngehalten werden und nicht im Flachwasser spielen.
Um zu bestimmen, ob ein Gewässer belastet ist, hilft laut Szewzyk ein einfacher Trick: "Erkennt man im knietiefen Wasser die Füße nicht mehr, enthält das Gewässer zu viele Cyanobakterien. Dann sollte man nicht mehr baden und sich ein anderes Badegewässer suchen."
Tipp 5: Möglichst wenig Wasser schlucken
Wer Wasser schluckt, kann Krankheitserreger aufnehmen. "Das lässt sich nicht immer vermeiden", erklärt die Mikrobiologin. "Pro Schwimmgang werden durchschnittlich 30 bis 50 Milliliter aufgenommen." Grundsätzlich gilt: Je weniger Wasser aufgenommen wird, desto geringer ist das Infektionsrisiko.

Tipp 6: Symptome ernst nehmen und andere informieren
"Juckt die Haut nach dem Schwimmen, bilden sich Pusteln oder treten andere Symptome auf, sollte immer ein Arzt aufgesucht werden", erklärt Regine Szewzyk. Nach erfolgter Diagnose sei es auch sinnvoll, die zuständige Landesbehörde zu informieren, die mit der Beurteilung der Wasserqualität beauftragt ist. "Diese sind für Tipps und Rückmeldungen bei Problemen mit der Wasserqualität immer sehr dankbar."