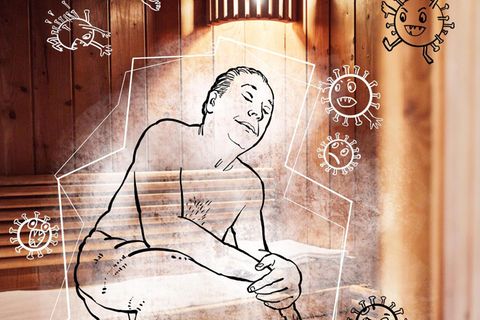Wer in einer Depression steckt, weiß: Das ist mehr als mal schlecht drauf sein, sich einfach zusammenreißen funktioniert nicht. Alles fühlt sich dumpf an, freudlos, das Interesse an der Außenwelt, dem Alltag schwindet und die leichtesten Dinge fallen schwer. Der Appetit lässt nach, der Schlaf ist gestört. Kurzum: Man ist vorübergehend schachmatt gesetzt.
Jeden fünften Bundesbürger sucht der "schwarze Hund" einmal im Leben heim. In Deutschland leiden derzeit rund vier Millionen Menschen an einer behandlungsbedürftigen Depression, schreibt die Stiftung Deutsche Depressionshilfe, die sich für eine bessere Aufklärung über die Krankheit einsetzt.
Meist sind es mehrere Faktoren, die zusammenkommen und einen Menschen an einer Depression erkranken lassen. Neben den Genen spielen auch die Umwelt und Botenstoffe im Gehirn eine Rolle. Bei Depressiven sind sie aus dem Gleichgewicht geraten, vor allem an Serotonin, einem stimmungaufhellenden Hormon, mangelt es. Hier setzen bestimmte Antidepressiva an, sogenannte Selektive-Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer. Sie sorgen dafür, dass sich die Serotonin-Konzentration im Gehirn wieder erhöht.
Doch bereits seit einigen Jahren richten Forscher ihren Blick auf eine andere mögliche Ursache, die Depressionen begünstigen könnte: ein überaktives Immunsystem. Richtet ausgerechnet die Abwehr des Körpers, die uns eigentlich schützen soll, in manchen Fällen Schaden an?
Das Immunsystem ist aus der Balance
Werden wir krank, fährt unser Immunsystem hoch. Das ist eine hilfreiche Reaktion des Körpers, er zwingt uns zur Ruhe, um die Krankheitserreger bekämpfen zu können. Wir fühlen uns müde, ausgelaugt, haben keinen Appetit, wollen von der Welt nichts wissen und igeln uns auf dem Sofa ein.
Auch wenn es nicht gleichzusetzen ist: Grob betrachtet ist das den Symptomen einer Depression nicht unähnlich. Könnte es also sein, dass entzündliche Erkrankungen und Depressionen eine gemeinsame Basis haben? "Ich halte das für einen vielversprechenden Ansatz", sagt Hubertus Himmerich, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Leipzig. Der Wissenschaftler beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren mit dem Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen und unserem Immunsystem.
Dieses funktioniert vereinfacht gesagt wie folgt: Sind Eindringlinge wie Viren in unseren Körper gelangt, setzt dieser eine Entzündungsreaktion in Gang. Sogenannte Zytokine, Eiweiße, die von den Zellen des Immunsystems ausgeschüttet werden, aktivieren und koordinieren die Abwehr und sorgen dafür, dass wir uns schlapp fühlen und unserem Körper eine Auszeit gönnen. Doch unsere Immunabwehr darf nicht nur aufgepeitscht werden. Bestimmte Zellen müssen auch dafür sorgen, dass sich die Reaktion irgendwann wieder abschwächt und sich das Immunsystem beruhigt.
Würde die Abwehr bei einer Depression eine Rolle spielen, hieße das: "Das Immunsystem wäre gleichsam aus dem Lot, es würde sich nicht mehr herunterregeln", sagt Himmerich. "Die Entzündungswerte im Blut müssten hoch bleiben."
Die Spur ist heiß
Tatsächlich entdeckten Forscher im Blut von depressiven Patienten erhöhte Werte für bestimmte Zytokine, Himmerich und sein Team konnten das auch in Studien bestätigen. Seitdem sind Wissenschaftler aus aller Welt dem Zusammenhang zwischen Depressionen und entzündlichen Prozessen auf der Spur - und sie haben weitere Hinweise gefunden, dass beide miteinander verbunden sein könnten.
So treten etwa bei Patienten mit Immunkrankheiten wie rheumatoider Arthritis oder Schuppenflechte Depressionen häufiger auf. Auch andersherum zeigt sich dieser Zusammenhang: "Depressive leiden häufiger an entzündlichen Darmerkrankungen, Allergien, Asthma und Neurodermitis", sagt Himmerich. Werden Patienten mit Hautkrebs oder einer chronischen Hepatitis-C-Erkrankung Medikamente mit den Immunbotenstoffen verschrieben, um ihr Immunsystem zu befeuern, entwickeln sie häufig Symptome einer Depression. Werden dagegen entzündliche Prozesse mit entsprechenden Medikamenten behandelt, verbessert sich mitunter auch die Stimmung.
Zwar ist noch nicht ganz klar, was Ursache und Folge ist: Lösen Entzündungsprozesse Depressionen aus oder sorgen Depressionen dafür, dass Entzündungsprozesse im Körper auftreten? Doch dass Zytokine unsere Stimmung beeinflussen können, ist durchaus möglich: "Es gibt verschiedene Theorien, wie die Immunbotenstoffe auf das Gehirn wirken", sagt Himmerich. So könne etwa ein bestimmtes Zytokin ein Enzym beeinflussen und so dafür sorgen, dass nicht ausreichend Serotonin im Gehirn gebildet werden kann.
Manche Forscher gehen mittlerweile sogar soweit, Depressionen als eine Infektionskrankheit zu bezeichnen, eine allerdings, die nicht ansteckend ist. Himmerich stimmt dem nicht zu: "Das ist überzogen, nicht alle Depressiven haben erhöhte Zytokinwerte", sagt er. "Es ist aber anzunehmen, dass zumindest bei einem Teil der Betroffenen Entzündungsprozesse eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Krankheit spielen."
Auch Stress spielt eine Rolle
Gegen eine Bezeichnung der Depression als eine infektiöse Krankheit spricht aus Sicht des Mediziners auch, dass Infektionen nicht der einzige Weg sind, Entzündungsprozesse in Gang zu setzen. Auch Stress spiele dabei eine Rolle. "In Tierversuchen konnten wir zeigen, dass soziale Isolierung, akuter und chronischer Stress ebenfalls zu einer dauerhaften Aktivierung des Immunsystems und seiner Botenstoffe führt", so der Leipziger Forscher.
Auch ungesundes Essen (viele Transfette und Zucker) fördert Entzündungen, während eine an Obst, Gemüse und Omega-3-Fettsäuren reiche Ernährung und Bewegung diese im Zaum hält. Ein anderer Risikofaktor: Fettleibigkeit, vor allem im Bauchfett lagerten große Mengen an Zytokinen. Dazu kommt Stress (auch durch Einsamkeit und Ablehnung), der ebenfalls die Werte dieses Botenstoffs im Blut ansteigen lassen kann.
Zivilisationskrankheit par excellence?
Sind Depressionen damit die Zivilisationskrankheit par excellence? Gleichsam eine "Allergie (bei der das Immunsystem ja auch verrücktspielt) gegen das moderne Leben", wie der "Guardian" schreibt. "Das ist durchaus ein interessanter Gedanke", sagt Himmerich. "Vor allem eröffnet er neue Ansätze in der Therapie." Doch momentan steckt die Forschung zu antientzündlichen Medikamenten und ihrem unterstützenden Einsatz bei Depressionen noch in den Kinderschuhen.
"Zytokinblocker wirken nicht bei allen und noch wissen wir zu wenig darüber, warum sie dem einen Depressiven helfen und dem anderen nicht", sagt Himmerich. Zudem hätten die Medikamente schwere Nebenwirkungen: "Der Eingriff ins Immunsystem kann dazu führen, dass sich etwa eine Tuberkulose oder Multiple Sklerose entwickelt", sagt der Mediziner.
Entzündungen im Körper komplett ausschalten zu wollen, ist ebenfalls keine gute Idee, denn der Körper muss sich ja wehren können. Eine Balance sei anzustreben, so Experten. Allerdings ist keine Behandlungsmethode bisher so weit ausgereift, dass sie gängige Antidepressiva ersetzen kann. "Im Moment ist der Einsatz von Zytokinblockern nur vertretbar, wenn Depressiven nichts anderes hilft", sagt Himmerich. "Und auch dann ist es immer noch ein Ausprobieren."
Andrew Miller, Psychiatrieprofessor an der Emory Universität in Atlanta, hat genauer untersucht, welche Depressionspatienten davon profitieren könnten. In einer kleinen Studie ermittelten er und seine Kollegen bei 60 schwer depressiven Patienten, die keine anderen Krankheiten hatten, zu Beginn die Entzündungswerte im Blut. Ein Teil der Patienten bekam bereits Antidepressiva, diese zeigten jedoch keine oder kaum Wirkung. Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen eingeteilt: Eine erhielt ein antientzündliches Medikament, die andere ein Placebo.
Bei den Patienten, die hohe Entzündungswerte hatten, besserten sich die depressiven Symptome, wenn sie das Medikament einnahmen. Patienten mit normalen Entzündungswerten erholten sich allerdings langsamer von der Depression als diejenigen, die ein Placebo bekamen. Antientzündliche Medikamente generell bei schwer behandelbaren Depressionen einzusetzen, mache keinen Sinn, schlussfolgern die Studienautoren. Menschen, die keine hohen Entzündungswerte haben, können sie sogar schaden.
Noch viel Forschung nötig
Vor allem für Ärzte seien die neuen Erkenntnisse wichtig, sagt Himmerich. "Wenn ein Patient mit depressiven Symptomen kommt, muss mitbedacht werden, dass auch eine entzündliche Krankheit dafür verantwortlich sein könnte. Wird diese behandelt, brauchen die Patienten möglicherweise keine Antidepressiva mehr."
Könnte es also irgendwann einmal Routine sein, dass bei Depressionspatienten Blut abgenommen wird, um den Zytokingehalt zu messen und die Therapie danach auszurichten? Himmerich kann sich das vorstellen. Doch der Weg dahin ist noch weit. "Momentan sind diese Tests noch wenig aussagekräftig, da bestimmte Zytokine nicht nur bei Depressionen erhöht sind, sondern etwa auch bei Tumorpatienten oder an Grippe Erkrankten vorkommen."
"Die Verbindung zwischen Entzündungen und Depressionen wird immer deutlicher, aber die gesamte Komplexität ist bis jetzt noch nicht erfasst", schreibt die Psychiaterin Maria Almond in der Fachzeitschrift "Current Psychiatry". "Doch das aufkeimende Bewusstsein für das Zusammenspiel von Stress, Entzündungen und Depressionen kann unseren Umgang mit der Krankheit und deren Behandlungsmöglichkeiten erweitern."