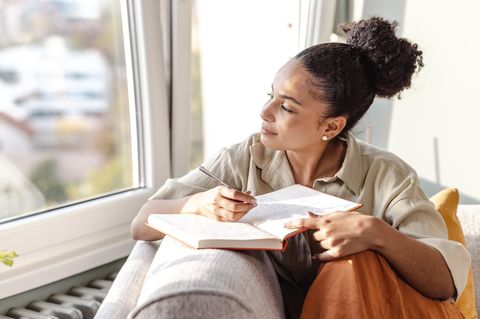Von Frank Ochmann
Was Glück ist? Dumm sein und Arbeit haben, hat der Arzt und Dichter Gottfried Benn gesagt, das ist das Glück. Mal ehrlich. Wie war das beim letzten Mal Glücklichsein? Abends auf dem Sofa mit leerem Kopf und dem Wollknäuel auf dem Bauch, das wohlig schnurrte, wenn die Finger durch sein Fell pflügten? Fliegenfischen, Gitarre spielen, ein Rausch von Rosen - war das schon Glück?
Uns fallen bestenfalls Minuten ein, die uns Fortuna ab und zu aus ihrem Füllhorn schenkt. Und einem anderen zu sagen, was uns in solchen Momenten von der Sohle bis zum Scheitel durchströmt, uns jubeln und jauchzen oder einfach nur still werden lässt und ein paar Tränen in die Augenwinkel treibt, das ist so schwer, wie einen Orgasmus zu beschreiben - nur wer Glück spürt, kennt es wirklich.
Jeder will glücklich sein
Ob Gefühl oder Gedankenkonstrukt - glücklich sein will offenbar jeder. 288 Vorschläge für den Pfad zum Paradies auf Erden zählte angeblich bereits der gelehrte Marcus Terentius Varro im antiken Rom.
Augustinus, der drei Jahrhunderte und einen Messias später davon berichtete, hatte für solche Glücksucher nur Verachtung, bestenfalls Mitleid übrig. "Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir", bekennt er seinem Christengott, verwirft alles irdische Glück und wird später dafür heilig gesprochen. Das wiederum hätte den heiteren Genussgriechen Epikur sehr amüsiert. Denn was nützt schon das Glück als Verheißung nach einem freudlosen Erdenleben? "Wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr", stellt der von Zeitgenossen als Schwein und Lüstling beschimpfte Philosoph lapidar fest. Also rein ins pralle Leben: "Ich weiß nicht, was ich mir als das Gute vorstellen soll, wenn ich die Lust des Geschmacks, die Lust der Liebe, die Lust des Hörens und den lustvollen Anblick einer schönen Gestalt beiseite lasse."
Dass das Glück, wenn überhaupt, eher diesseitig zu finden ist, hat sich trotz Augustinus und aller folgenden Jenseitsprediger in unserem Kulturkreis durchgesetzt. Bloß wie man das macht, glücklich werden, das scheint für viele bis heute eine Geheimwissenschaft zu sein. Immerhin scheint uns tief im Inneren eine Stimme zu sagen, dass Glück nicht nur Geschenk ist: Wir können danach suchen, wir können unser Glück auch finden und mit etwas Geschick daran "arbeiten", damit es sich nicht gar zu schnell wieder davonmacht. Hätten wir diese Hoffnung nicht, brauchte es nicht Massen von Ratgebern, die Buchhändler in ihren Regalen und Computern bereithalten: Auf fast zweieinhalbtausend Titel zum Thema kommt gleich die erste Datenbankrecherche. Kaum eine wöchentliche Bestseller-Liste ohne wenigstens einen Happymacher. Doch wer dann das so gut wie garantierte Glück auf 300 Seiten kauft und die angepriesenen Seelenschwingen ausprobiert, merkt meist ziemlich schnell, dass es beim Glücklichwerden nach Einheitsrezept auch nicht besser geht als beim vorigen Versuch, der Taille mehr Form abzuringen. Also weg mit der Psycho-Schwarte und kapitulieren? Zurück ins Alltagseinerlei statt noch mehr Glücksstress ertragen müssen? Nicht so hastig. Es gibt doch glückliche Menschen. Ziemlich viele sogar.
Die Schweizer sind am glücklichsten
Alphorn, saubere Gehsteige, Schoki. Viel mehr braucht es vielleicht gar nicht. Genaue Uhren noch dazu und eine Volksabstimmung hin und wieder. Die Schweizer jedenfalls sind, wissenschaftlich beglaubigt, derzeit die Glücklichsten auf Erden: strahlende 8,1 Punkte erzielen sie auf der bis 10 reichenden Skala nationalen seelischen Wohlbefindens. Auf 6,7 bringen es immerhin die Deutschen - vor Steuern und Zinsen. Wie es aber in den Herzen und Köpfen der nach dem Ende der Sowjetunion tief gefallenen Moldawier aussieht, fragt man besser nicht: klägliche 3 Punkte, letzter Platz von 67 seit Jahren immer wieder aufs Glück untersuchten Ländern.
Das Sprichwort weiß es, und Philosophen und Heilige aller Religionen haben es uns immer wieder eingetrichtert: "Sein" ist wichtiger als "Haben". Viel gefruchtet hat das bislang offenbar nicht, sonst würde sich keiner mehr wegen seiner akademischen Titel oder der Villa im Tessin aufplustern. Vielleicht fällt die Einsicht ins wahre Glück leichter, wenn sie nicht nur gepredigt, sondern auch wissenschaftlich untermauert wird.
Das Ergebnis solcher Untersuchungen ist eindeutig: Wohlstand garantiert kein Wohlbefinden. Zwar schlagen uns krasse Unterschiede, die Opfer der Vielen für die Privilegien der Wenigen, heftig aufs Gemüt. Aber Geld an sich macht nicht glücklich, auch nicht ein Sprung hinauf auf der Karriereleiter.
Mammon und Macht sind keine Garantie
Zumindest nicht, wenn Mammon und Macht allein die Stimmung heben sollen. Der Psychologe David Myers vom Hope College in Michigan und sein Kollege Ed Diener von der Universität von Illinois publizierten dazu eine grundlegende Studie: Während sich das Pro-Kopf-Einkommen in den USA von 1930 bis 1990 etwa vervierfachte, blieb der Anteil der ausgesprochen Glücklichen nahezu unverändert bei einem Drittel der Bevölkerung - it's not the economy, stupid. Auch nicht Sozialstatus, Hautfarbe oder Geschlecht. Beim Lebensglück ist es vielmehr wie bei der Malerei: Mag der Rahmen noch so edel sein, er kann letztlich nicht darüber hinwegtäuschen, wenn er stümperhaftes Gekrakel umschließt - würde sich sonst auch nur ein Millionär die Kugel geben?
Noch etwas nimmt dem Reichtum die Kraft zum Glücklichmachen, und auch das ist wissenschaftlich bestens belegt: Wir gewöhnen uns von Natur aus ziemlich schnell an fast alles. Zum Glück. Denn diese Fähigkeit erlaubt uns seit Jahrzehntausenden, mit einer Welt fertig zu werden, die nur selten unseren Wünschen entspricht. Da hilft es im Ernstfall, nüchtern zu bleiben und ohne allzu lange Panikattacken einen Weg raus aus dem Schlamassel suchen zu können. Nachteil dieser guten Gabe: Auch die Wogen der Begeisterung verebben ziemlich schnell. Ob sich darum 10 oder 20 Millionen im Depot stapeln, sie werden nicht aufregender, je länger sie dort liegen. Und selbst wenn der nächste Crash das Portfolio zu Staub zerbröselt, auch der tiefste Schmerz geht vorbei. Nicht nur an der Börse.
Selbst der schlimmste Verlust wird verkraftet
Wenn Trauernde das zum ersten Mal an sich bemerken nach dem Verlust eines Menschen, mit dessen Leben ihr eigenes verschmolzen war, dann kann das nach Monaten wieder keimende eigene Glück leicht ein schlechtes Gewissen machen. Das erste befreite Lachen scheint wie ein Frevel. Aber ist es nicht wirklich beruhigend, wenn uns selbst der schlimmste Verlust nicht ganz und gar umhaut? Wenn wir uns wieder aufrappeln und sogar die für immer verloren geglaubte Freude am eigenen Leben wiederentdecken können? Die wird dann natürlich selten gleich überschäumen. Muss sie auch gar nicht. Viel wichtiger als das gelegentliche Glück in Ekstase, versichern Psychologen, ist eine ruhige positive Grundstimmung, die das Leben tragen kann. Es sind die kleinen und für sich so vergänglich scheinenden Freuden, mit denen wir Tag für Tag am großen Glück bauen können, das am Ende ein ganzes Leben mit allen Höhen und auch den Tiefen umschließen kann.
Ein Mensch ist in dem Maße glücklich, sagt der Glücksforscher Ruut Veenhoven von der Rotterdamer Erasmus-Universität, in dem er sein Leben als Ganzes bejaht. Revolutionspropheten schmeckt das natürlich nicht. "Glück ist kein zeitgemäßes Gefühl", verkündete Jean Amory in den Siebzigern. Und im von der Partei diktierten DDR-Lexikon war Glück definiert als "gehobene innere Zufriedenheit über gute Taten und fortschrittliche Leistungen". Alles Quatsch. Warum sollte sich jemand dafür schämen müssen, sein Leben erst einmal einfach nur für sich selbst zu bejahen und zu genießen? Uns das zu erlauben ist der erste Schritt zum Glück. Das schadet keinem anderen. Selbst der lustvolle Epikur war kein unausstehlicher Egomane. Askese predigende Griesgrame sind der beste Beweis: Wer nicht genießen kann, wird schnell ungenießbar.
Von pudelwohl bis hadernd...
Unsere Ausgangsposition ist gar nicht schlecht. Den allermeisten geht es nach eigener Einschätzung aufs Ganze gesehen sogar erstaunlich gut, zeigen Untersuchungen wie die von Veenhovens Team. Wenn Tausende von Menschen mit ausreichendem - nicht notwendig üppigem - Lebensrahmen auf einer Skala von 1 bis 10 ein Urteil über ihr eigenes Glücksempfinden fällen, sollte der Durchschnitt genau in der Mitte liegen: Einige müssten sich pudelwohl fühlen, andere gerade mit ihrem Schicksal hadern, und die meisten würden wir irgendwo dazwischen vermuten. Alles in allem genauso viele auf der glücklichen wie auf der unglücklichen Seite. Tatsächlich liegt der Durchschnitt deutlich höher. Es geht mehr Menschen gut als schlecht. Und zwar nach ihrer eigenen Einschätzung.
Da Kultur und Besitz - und übrigens auch der Grad der Frömmigkeit - dabei keinen großen Unterschied machen, liegt der Grund offenbar in unserer Natur. Es scheint, dass sich im Laufe der Jahrtausende eher die Optimisten unter unseren Urahnen durchgesetzt haben. Und beim zweiten Nachdenken ist es schon gar nicht mehr verwunderlich, wenn es besonders unsere Vorfahren mit gesteigerter Lebensfreude waren, die ihre Gene bis zu uns durchreichen konnten. Zuversicht schafft Kraft. Und wer nur trist und träge ist, muss sich auch heute noch darauf gefasst machen, bei der Partnerwahl sitzen zu bleiben - Trübsal macht nicht sexy.
Jeder hat seinen Stimmungsschwerpunkt
Aber es sind halt nicht alle coole Siegertypen mit Stahl im Blick und immer so was von gut drauf. Die Stilleren und von der Sonne vielleicht nicht ganz so Gewärmten mag es trösten, dass auch Glückskinder Trauer kennen, Einsamkeit und Unbehagen mit sich selbst. Vorausgesetzt, es gibt in ihrem Kopf keinen gravierenden Strickfehler. Kein gesunder Mensch bewegt sich nur auf der einen oder anderen Seite des Stimmungsspektrums. Doch auch wenn sich in der Tendenz die meisten eher auf der hellen als auf der dunklen Hälfte einordnen, wie die Statistik der Glücksforscher zeigt, liegt jedes Gemüt auf einem anderen Niveau. Da sind dann wirklich nicht alle gleich. Jeder von uns trägt in seinem Inneren eine Art Stimmungsschwerpunkt, der seiner Natur entspricht und um den das Gemüt ein Leben lang pendelt. David Lykken und Auke Tellegen, Psychologen und Verhaltensforscher an der Universität von Minnesota in Minneapolis, haben in ihren Forschungsarbeiten zeigen können, wie sehr unser Stimmungsschwerpunkt genetisch bestimmt ist - fast zu 100 Prozent.
Für die angenehmen Gefühle und auch ihr Gegenteil ist in unserem Gehirn ein eigener "Apparat" reserviert, dessen Aufbau nach dem Bauplan im Erbgut erfolgt. Das fängt im Mutterleib an und setzt sich nach der Geburt noch eine ganze Zeit weiter fort. Schon früh wird das Werk der Gene in uns von den Erfahrungen mitgeformt, die wir in einer mal freundlichen, mal feindlichen Welt machen. Botenstoffe übertragen unsere jeweilige Stimmung zwischen den biologisch uralten Gefühlszentren tief in unserem Kopf, wo es im Finstern brodelt und rumort, und Teilen der jüngeren und darüber liegenden Großhirnrinde, wo unser Bewusstsein und der kühle Verstand ihre Heimat haben. Diese Kommunikation in unserem Kopf ist wichtig, denn wir hätten nichts von den schönsten Gefühlen, wenn sie nicht bis in unser Bewusstsein gelangten. Fließt etwa Serotonin in Strömen, scheint die Sonne in unsere Seele. Dopamin, ein anderer Botenstoff, vermittelt Gefühle der Belohnung und des Vergnügens und setzt zudem so genannte Endorphine frei, die uns den Schmerz nehmen. Und der ist, so paradox es klingt, mit den Glücksgefühlen eng verwandt. Denn die guten wie die schlechten Gefühle helfen uns, einigermaßen heil durchs Leben zu kommen. Schon Kleinkinder - und auch Laborratten - meiden, was ihnen Schmerzen bereitet, und suchen, was ihnen Vergnügen schenkt.
Jeder hat eine Chance trotz Genetik
Auch wenn der Gefühlsapparat in unseren Köpfen nur innerhalb seiner biologisch gesetzten Grenzen arbeiten kann, braucht niemand zu verzweifeln. Denn zum einen gehören wir Menschen - siehe oben - zu einer ziemlich glücklichen Art. Jeder Einzelne darf also darauf hoffen, von der Natur mit einem aufmunternden Klaps ins Leben geschickt worden zu sein. Zum anderen ist unser Schicksal selbst dann nicht besiegelt, wenn wir aus einer Familie stammen, die das Unglück gepachtet zu haben scheint. Denn das mittlere Glücksniveau unseres Lebens ruht zwar auf einem bestimmten genetischen Fundament, es ist deswegen aber nicht schon erblich. Dafür kommen zu viele Komponenten zusammen. Andere komplexe menschliche Eigenschaften können verdeutlichen, was gemeint ist. Ob wir beispielsweise die Anlage zu einer Jahrhundertstimme wie Caruso oder die Callas haben, ist ebenfalls fast vollständig genetisch bestimmt - durch den Aufbau unseres Kehlkopfes, der Stimmbänder und des Mund- und Rachenraumes. Und auch etwas weiter oben im Kopf muss alles stimmen: Musikalisch sollten wir sein, vielleicht haben wir sogar das - genetisch vorgegebene - absolute Gehör. Durch die Vielzahl der beteiligten Komponenten wird es aber sehr unwahrscheinlich, dass uns schon deshalb eine Gesangskarriere sicher ist, weil Mutti oder Vati oder sogar beide Gold in der Kehle haben. Nur weil sich in ihrem Hals alles glücklich zusammenfügte, muss das bei ihren Nachkommen keinesfalls so sein.
So bedeutet auch die fast völlige genetische Vorbestimmung unserer - durchschnittlichen - Gemütslage nicht, dass wir per DNA unwiderruflich und unverrückbar im Leben auf Gedeih oder Verderb festgelegt wären. Nur wer seinem "genetischen Steuermann" willenlos freie Hand lässt, bestätigt der Verhaltensforscher David Lykken, macht sich selbst zum Gefangenen seiner Gene. "Aber es ist dein Leben. Und innerhalb weiter Grenzen kannst du deine Ziele selbst wählen, anstatt sie für dich bestimmen zu lassen." Das klingt doch ermutigend. Auch wer kein musikalisches Ausnahmetalent ist, kann es schließlich mit Engagement weit bringen. Dagegen nützt eine noch so brillante Begabung nichts, wenn wir sie verkommen lassen. Auf die Einstellung kommt es also vor allem an - auch fürs glückliche Leben. Und daran können wir arbeiten.
Es wird uns vermutlich schon ein wenig glücklicher machen, wenn wir unsere Erwartungen an das Leben nüchtern prüfen und, falls nötig, korrigieren - normalerweise ein Stück nach unten. Wer 70, 80 oder 90 Jahre wunderbaren Wohlbefindens anstrebt, ist garantiert auf dem Holzweg und bereitet sich selbst seine Enttäuschungen. Ausgedehnte Studien amerikanischer Forscher an rüstigen Hundertjährigen in der bahnbrechenden "New England Centenerian Study" bestätigen diese Weisheit. Denn so unterschiedlich ihr keinesfalls immer leichtes Leben verlaufen war, in einem stimmten die frohgemuten Greise alle überein: Sie sagten, sie hätten jeden Morgen einen guten Grund aufzustehen. Den Anruf der Enkel nach der Schule etwa oder die wöchentliche Romme-Runde - mit dem kleinen Glück wird das große gebaut, nicht vom Schicksal, sondern von uns selbst.
Das Gehirn bedankt sich für den kleinsten Kick
Weil unser Gehirn ganz genügsam ist, bedankt es sich auch schon für den kleinen Kick mit guten Gefühlen und schickt unsere Seele in das Land, wo Serotonin und Dopamin fließen. Glück, so hat der französische Philosoph Voltaire schon vor mehr als 200 Jahren behauptet, sei eine Folge angenehmer Gefühle. Psychologen und Hirnforscher geben ihm heute Recht. Und es ist gar nicht so schwer, die angenehmen Gefühle zu finden.
Jeder kann sich an Situationen erinnern, in denen es ihm richtig gut ging. Situationen, die wir uns zurückholen können. Erlauben wir uns das hin und wieder und nicht zu selten, hebt das unser gesamtes Lebensgefühl. Das bestätigen die Glücklichen, die ihren eigenen Weg gefunden haben, der Seele immer mal wieder Flügel anzuschnallen.
"Nach 45 Minuten Laufen spüre ich einen Kick", sagt Ann-Kristin Nuernbergk."Dieses gute Gefühl nehme ich mit in den Alltag." Und manch einer findet das Glück dieser Erde auf dem Rücken der Pferde. "Ein freier Tag, tolles Wetter, und wir zusammen bei den Pferden: Das ist absolutes Glück!" Für Svenja Rühne und ihre Mutter Agneta jedenfalls. Vergängliches Glück, sicher. Aber ein weiteres freies Wochenende kommt bestimmt, die Sonne lacht, und die Pferde wiehern. Andere bekommen ihren Kick im Gebirge, beim Wattwandern, mit einem dicken Buch im kuschligen Sessel oder wenn sie wie schwerelos durchs Wasser gleiten. Oder wie wäre es mit einem Bohrer in der Hand oder einem Lötkolben? Rosenschneiden im Garten oder einfach nur Daddeln am Computer?
Unsere "Glückskondtion" lässt sich verbessern
Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt und die Chancen für jeden gut, etwas Passendes zu finden. Wichtig ist dabei nicht die Intensität des Gefühls, das wir uns verschaffen, sondern dass wir es uns regelmäßig gönnen, unsere Seele ein kleines bisschen zu liften. Auch körperliche Kondition, sagen Ärzte, gewinnen wir nicht, wenn wir einmal im Monat den Puls hochjagen. Mäßige und regelmäßige Übungen dagegen stärken Muskeln und Kreislauf auf Dauer. Und mit dem gleichen Willen und Augenmaß können wir offenbar auch unsere "Glückskondition" verbessern. "Life sucks, then you die", sang die Rockband Fools vor einigen Jahren - frei übersetzt: Erst kotzt dich das Leben an, dann stirbst du. Dass wir einmal auf der Bahre liegen werden, ist nicht zu ändern. Aber wie es uns in den Jahrzehnten davor ergeht, haben wir selbst mit in der Hand. Nicht alle sind beim Schmieden ihres Glücks mit dem gleichen Geschick gesegnet. Doch Übung kann helfen zu ersetzen, was der Begabung fehlt. Die Summe unserer Jahre entscheidet jedenfalls nicht allein das Schicksal. "Wie könnte das Größte und Schönste von einem bloßen Zufall abhängig sein!", ruft uns Aristoteles ermutigend aus der Antike zu. Soweit wir heute wissen, hatte er Recht. Ob wir glücklich werden in unserem Leben, ist nicht nur Glückssache.