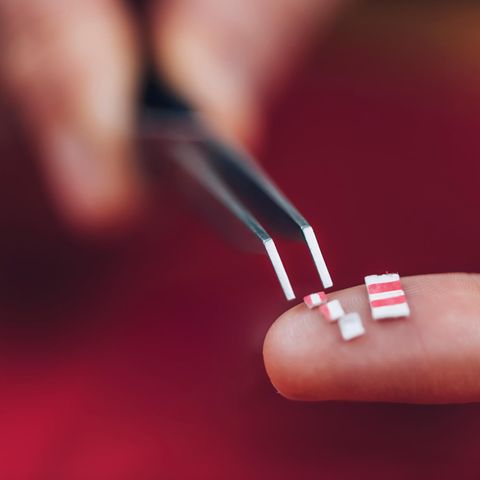Es ist längst kein Geheimnis mehr: Wer in Deutschland einen Therapieplatz sucht, der braucht meist eine ordentliche Portion Geduld und Durchhaltevermögen. Die Wartezeiten von der Diagnosenstellung bis zum Therapiebeginn belaufen sich im Schnitt auf mindestens einen Monat in der Stadt bis hin zu einem Jahr auf dem Land. Dass das für die Betroffenen problematisch ist, liegt eigentlich auf der Hand, die Symptome der psychischen Erkrankung warten schließlich nicht, bis endlich jemand da ist, der sich ihrer annimmt. Sie bleiben – und beeinträchtigen weiterhin das Leben der Patient:innen.
Wie stark die Auswirkungen der Wartezeit wirklich sind, hat nun ein Forschungsteam aus den Niederlanden untersucht. Die Wissenschaftler der Universität Maastricht haben dafür unter der Führung von Psychologin Dyllis van Dijk die Daten von 715 Patient:innen untersucht, die wegen einer depressiven Episode in Behandlung waren. Sie sollten zu verschiedenen Zeitpunkten Fragebögen zu ihrer mentalen Verfassung beantworten.
Lange Wartezeit fördert Chronifizierung
Das Ergebnis der Analyse war deutlich: Je länger die Teilnehmer nach dem Erstgespräch auf den Behandlungsbeginn warten mussten, desto geringer waren die Therapieerfolge nach sechs Monaten. Verschlechtert haben sich die Symptome allerdings auch nicht. Der Grund für die schlechteren Behandlungserfolge liegt also nicht in einer Verschlimmerung der Erkrankung. Vielmehr vermuten die Forschenden, dass eine fortschreitende Chronifizierung einsetze, wenn die Behandlung später startet. Außerdem könne sich die Wartezeit demotivierend auf die Betroffenen auswirken und noch vorhandene Selbstheilungskräfte von depressiven Menschen schwächen.
Frühere Untersuchungen zeigen, dass Depressionen nicht das einzige Krankheitsbild sind, bei dem lange Wartezeiten ein Problem darstellen könnten. Auch Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen und Essstörungen könnten sich durch eine zu späte professionelle Hilfe chronifizieren. So hat etwa die Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin erst im April die mangelhafte Versorgung von jungen Autismus-Patienten bemängelt – es dauere teilweise länger als ein Jahr, bis die Therapie starte.
Lange Wartezeiten auf dem Land
Die langen Wartezeiten sind vor allem mit der stark reglementierten Vergabe der Kassensitze für Psychotherapeuten begründet. In der Stadt gilt aktuell ein Schlüssel von einem Kassen-Therapeuten für 3000 Menschen, auf dem Land geht man davon aus, dass ein Psychotherapeut für 6000 Menschen ausreicht. Soweit die Theorie. Die Realität ist eine andere. Zwar hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sich die Ausweitung der Kassensitze bei Amtsbeginn auf die Fahne geschrieben – passiert ist dahingehend allerdings bislang recht wenig.
Dabei weiß man in der Branche nicht erst seit gestern um die Relevanz eines schnellen Therapiebeginns. Peter Henningsen, Direktor der Klinik für Psychosomatik am Münchner Klinikum rechts der Isar sagte dazu im Gespräch mit der "Tagesschau" in Bezug auf die Auswirkungen der Wartezeiten: "Dann werden Patienten zum Teil stationär behandlungspflichtig, die das nicht gewesen wären, wenn sie schneller in eine angemessene ambulante Therapie gekommen wären."
Wartezeit auf Psychotherapie überbrücken
Die strukturellen Hürden, die derzeit noch zwischen den Betroffenen und einem schnellen Therapieplatz stehen, lassen sich im individuellen Rahmen nur bedingt auflösen. Und trotzdem gibt es für Menschen, die unter einer akuten psychischen Krise leiden, mehrere Wege, die schwierige Wartezeit auf den Therapiebeginn sinnvoll zu überbrücken.
Akutbehandlung
Wer tief in einer psychischen Krise steckt, der kann mit Hilfe seiner Krankenkasse oder seines Hausarztes eine Akuttherapie beantragen. Diese wird in der Regel über den Patientenservice der Krankenkassen vermittelt, wenn auf der Überweisung ein entsprechender Akut-Code steht. Hier darf die Wartezeit nicht länger als zwei Wochen dauern. Die Akuttherapie dient dazu, die Patient:innen zu stabilisieren und umfasst höchstens 12 Stunden.
Online-Therapie
Vor allem für Menschen, die an Depressionen oder Angststörungen leiden, ist der Gang zum Psychotherapeuten oft eine große Herausforderung. Wer schon am Telefon oft abgelehnt wird, der verliert nicht selten die Hoffnung, doch noch einen Therapieplatz zu bekommen. Hier bieten Online-Therapien eine sinnvolle Alternative, um sanft in die Therapiepraxis einzusteigen. Anbieter wie "Selfapy" oder "BetterHelp" ermöglichen Betroffenen einen einfachen Zugang zu ihrem Programm und arbeiten eng mit Psychotherapeuten zusammen. Den Zugang erhalten Patienten meist über ein entsprechendes Rezept von ihrem Hausarzt.
Selbsthilfegruppe
Hilfe zur Selbsthilfe – das ist das Prinzip von Selbsthilfegruppen. Und der Austausch mit anderen Menschen, die ähnliche Probleme haben, wie man selbst, kann durchaus heilsam sein. Und vor allem in der Wartezeit auf einen Therapieplatz eine wertvolle Stütze sein, die erste Ansätze liefern kann, wie man mit den eigenen Sorgen und Symptomen umgehen kann. Gruppen sind übrigens nicht nur zur Überbrückung gut, sondern auch eine gute Ergänzung zur Psychotherapie.
Beharrlichkeit
Das Wichtigste zum Schluss: Wer einen Therapieplatz sucht, der muss mitunter beharrlich sein und ein ausgeprägtes Durchhaltevermögen aufweisen. Das fällt vor allem Menschen mit psychischen Erkrankungen oft nicht leicht. Jeder einzelne Anruf kostet dann im Zweifel Kraft, die man eigentlich in die eigene Genesung stecken sollte. Trotzdem lohnt er sich, denn er könnte der erste Schritt in die Therapie und damit der erste Schritt Richtung Besserung sein.
Und wer es nicht selbst schafft, den zehnten Psychotherapeuten anzurufen, der wählt vielleicht die Nummer eines Freundes und fragt, ob er das übernehmen kann. Die wichtigste Form der Unterstützung finden wir ohnehin oft am ehesten in unserem engsten Umfeld, wenn wir uns einmal überwinden und uns mitteilen. Gemeinsam lässt sich dann auch die Wartezeit bis zum Therapiebeginn einfacher überbrücken.
Rat und Hilfe
Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter (0800) 1110111 und (0800) 1110222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.
Quellen: Studie zu den Auswirkungen von Wartezeiten, Ärzteblatt, ZDF heute, Tagesschau