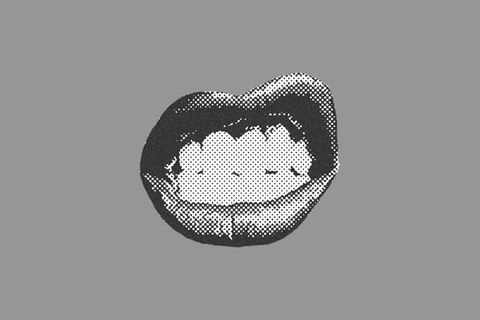Meine Blutspur zieht sich längs über den Flur, quer durch mein Schlafzimmer, bis hin zu meinem Bett. Dort sitze ich neben meiner Giraffe und der grünen Schlange und dem Hasen und sehe zu, wie Harry einen Verband um meinen Arm wickelt. Erst um den rechten. Dann um den linken. Das Blut sickert durch. Mir wird kalt. Noch kälter als sonst. Vielleicht sollte ich zu einem Arzt gehen. Harry hat schon dreimal gefragt. Aber ich will nicht. Ich will lieber schlafen. Ich spüre sowieso nichts mehr. Die Schnitte tun nicht weh.
(Aus: Lilly Lindner, "Winterwassertief")
Mit sechs Jahren verlässt Lilly Lindner ihren Körper. Ein Nachbar vergewaltigt sie, immer wieder. Irgendwann zieht er weg, doch der Schmerz in Lilly bleibt. Mit Messern und Rasierklingen versucht sie, ihn "aus sich herauszuschneiden", erzählte sie dem stern. Nur wenn sie das Blut über ihre Unterarme laufen sieht, weiß sie, dass sie noch ein Mensch ist. Zu der Ritzerei gesellen sich ihre beiden Freundinnen "Ana" und "Mia" - so nennt sie Anorexie und Bulimie, die sie durch diese Zeit tragen. Irgendwann wiegt sie keine 40 Kilo mehr. "Jahrelang wollte ich nur verschwinden."
Mit 19 wird Lilly Lindner wieder vergewaltigt. Hiernach hilft auch das Ritzen nicht mehr. Sie greift zu einem noch drastischeren Mittel, sich selbst zu verletzen: sie prostituiert sich. "Prostitution ist der höchste Grad der Selbstverletzung", sagt sie heute. Lillys Geschichte klingt paradox und in sich doch logisch: Denn nur das Gefühl ihren Freiern ausgeliefert zu sein, konnte ihr nach Feierabend auch das Gefühl geben, davongekommen zu sein. "Ich war süchtig nach diesem Gefühl des Überlebens und Davonkommens". Denn auf diese Weise konnte sie das überhaupt noch spüren: "Ich lebe noch, ich bin noch da."
Hilfe für Betroffene und Angehörige
Verletzen Sie sich selbst oder fügt sich ein Angehöriger Verletzungen zu? Informationen, Hilfe und Beratungsangebote finden Sie unter anderem bei folgenden Einrichtungen:
•Selbsthilfegruppe Rote Linien
•Onlinecommunity Rote Tränen
•Bei allen Ärzten, Psychologen, Psychotherapeuten und psychotherapeutischen Einrichtungen
•Eine erste Anlaufstelle kann auch die Telefonseelsorge sein (0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222; der Anruf ist kostenfrei).
•Mehr über die Spezialambulanz für Risikoverhalten und Selbstschädigung, die an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Uniklinikums Heidelberg angesiedelt ist, erfahren Sie hier.
Selbstverletzung ist kein Randphänomen
Auch wenn Lilly Lindners Geschichte extrem ist, selbstverletzendes Verhalten bei Jugendlichen - am bekanntesten ist das sogenannte Ritzen - ist keine Seltenheit. "Etwa jeder dritte Jugendliche in Deutschland verletzt sich in seinem Leben einmal bewusst selbst", sagt Michael Kaess, geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Kinder und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik Heidelberg und Leiter der dort angesiedelten Ambulanz für Risikoverhalten und Selbstschädigung bei Jugendlichen. Etwa fünf bis zehn Prozent verletzten sich wiederholt - sie ritzen etwa über einen längeren Zeitraum immer wieder.
Neben dem Ritzen fallen auch das Aufkratzen von Wunden oder Hautstellen, das Schlagen gegen Gegenstände oder sich selbst Verbrennen und Verbrühen unter sogenanntes selbstschädigendes Verhalten. "Allen Formen ist gemein, dass es sich um eine zielgerichtet herbeigeführte Verletzung der Körperfläche handelt, die in der Regel in nicht suizidaler Absicht geschieht und kulturell nicht akzeptiert ist, anders als Piercing oder Tattoos", sagt Kaess. Als eigenständige Diagnose wird dieses schädliche Verhalten bis jetzt in den Diagnosemanualen in den USA oder Europa zwar nicht geführt. "Es fällt unter potenzielle Störungsbilder, die noch weiterer Erforschung bedürfen", sagt der 35-Jährige. Doch vieles darüber, warum Jugendliche dies tun und wie man ihnen helfen kann, ist bereits bekannt.
Jungen betrifft die Störung auch
So sind Mädchen etwa doppelt so häufig betroffen wie Jungen. Vor allem bei Jungen vermuten die Forscher aber eine hohe Dunkelziffer. "Die Krankheit ist beim männlichen Geschlecht noch stärker stigmatisiert, Betroffene trauen sich oft nicht an die Öffentlichkeit und nehmen auch Therapien selten in Anspruch", sagt Kaess. In der Heidelberger Ambulanz etwa kommt auf zehn Mädchen ein Junge. "Das ist problematisch, da wir so nur wenig darüber erfahren, wie sich diese Selbstverletzungen speziell bei Jungen äußern und wie ihnen am besten zu helfen ist."
Mit dem selbstschädigenden Verhalten beginnen Jugendliche meist zwischen dem 10. und 14. Lebensjahr. "Am häufigsten kommt es im Alter zwischen 14 und 16 Jahren vor ", sagt Kaess. Studien zufolge tritt das selbstschädigen Verhalten selten vor der Pubertät auf und nur eine Minderheit entwickelt daraus eine chronische Erkrankung, die bis ins Erwachsenenalter anhält. "Die Zeit arbeitet also für die Jugendlichen", sagt Kaess, bei vielen hört das Ritzen mit zunehmendem Alter auch ohne Therapie auf. Dennoch warnt der Arzt davor, es auf die leichte Schulter zu nehmen. "Die zugrundliegenden Probleme und Störungen können bestehen bleiben und den Menschen weiterhin in seinem Alltag belasten."
Selbstverletzungen treten meist gepaart mit anderen psychischen Erkrankungen auf - etwa mit einer Depression oder der Borderline-Störung. "Allerdings haben nicht alle Jugendlichen, die sich selbst verletzten, eine psychische Störung", betont der Mediziner. Auch frühkindliche Traumata, Probleme in der Familie, eine schwierige Beziehung zu den Eltern oder Mobbing zählen zu den Risikofaktoren.
Lilly Lindner: "Winterwassertief", Verlag Droemer & Knaur, 368 Seiten, 12,99 Euro, ISBN: 978-3-426-30423-5.
Ritzen hilft, mit negativen Emotionen umzugehen
Ritzen sich Jugendliche, wird häufig eine Verbindung zu sexuellem Missbrauch gezogen. Doch Kaess warnt davor, dies vorschnell zu tun. "Lange nicht alle, die sich so schädigen, wurden als Kind missbraucht", sagt er. "Es ist einer von vielen Risikofaktoren, wenn auch sicher der, der besonders betroffen macht und das Umfeld wachrüttelt." Abzugrenzen ist das Ritzen von selbstschädigendem Verhalten wie Alkoholmissbrauch oder Essstörungen, bei denen die Verletzung des Körpers teilweise ein ungewollter Nebeneffekt ist.
Doch warum schneiden sich Jugendliche, bis sie bluten? "Das Umfeld nimmt meist an, dass die Mädchen oder Jungen dies tun, um Aufmerksamkeit zu erhalten", sagt Kaess. "Sie betrachten es als einen Hilfeschrei, als eine perfide Art, andere Menschen zu manipulieren oder bestimmte belastende Situationen - etwa eine Prüfung - zu vermeiden." Nicht selten, so der Mediziner, würden Eltern auch denken, dass sich ihre Kinder aus Rache selbst schädigen. "Das führt leider häufig zu Vorurteilen oder Vorwürfen. Diese Funktionen gibt es, aber sie sind meist nicht der Hauptgrund."
Befragt man die Betroffenen, zeige sich: "Das Verhalten hilft ihnen in erster Linie, Affekte zu regulieren", sagt Kaess. Auch Studien bestätigen: Selbstverletzendes Verhalten ist eine Bewältigungsstrategie, um inneren Spannungen abzubauen und mit Emotionen umzugehen. Ganz befremdlich ist das nicht, wenn auch in einer milderen Form: "Wir alle haben schon einmal aus Wut mit der Faust gegen die Wand geschlagen", sagt Kaess. "Das hilft, den Ärger zu verdauen. Der körperliche Schmerz überdeckt den seelischen."
Seit einiger Zeit beobachten Forscher auch, was bei Selbstverletzung im Körper passiert. "Dabei schüttet der Körper unter anderem Endorphine aus, die schmerzlindernd und euphorisierend wirken", sagt Kaess. "Den genauen Mechanismus kennen wir zwar noch nicht, aber eventuell lässt sich so erklären, warum Ritzen den seelischen Schmerz lindert."
Unfähig, den Schmerz zu spüren
Lilly Lindner erzählte dem stern: "Ich war richtig gut darin, meinen Körper zu misshandeln… Das Schöne daran war, ich habe ja nie was gespürt - ich sah halt zu, wie es blutet." Diese Unfähigkeit, den eigenen Körper zu spüren, ist bei Ritzern ebenfalls nicht selten. "Wir wissen, dass traumatisierte Jugendliche oftmals bestimmte Funktionen des Körpers vom Bewusstsein abkoppeln", sagt Kaess. "Sie erinnern sich nicht mehr an Dinge oder nehmen Schmerzen kaum wahr." Das Ritzen hilft dann, gegen die innere Leere anzugehen. "Dadurch nimmt die Schmerzwahrnehmung langsam wieder zu", sagt Kaess.
Daneben sind die Verletzungen - vor allem bei traumatisierten Jugendlichen - auch eine Art der Selbstbestrafung. "Sie wachsen häufig mit chronischen Schuld- und Schamgefühlen auf, die sich so äußern", sagt der Heidelberger Arzt. Ein Suizidversuch sind die Schnitte in der Regel nicht. "Das Risiko dafür ist jedoch bei Ritzern erhöht", sagt Kaess. Auch vor diesem Hintergrund plädiert er dafür, die Störung zu behandeln.
Vor allem auch, da sich Ritzen gut therapieren lässt. "Ein Großteil der Jugendlichen, die bei uns in Therapie sind, zeigt nach sechs Monaten einen deutlichen Rückgang der Symptome bis hin zum völligen Verschwinden des schädigenden Verhaltens", sagt der Arzt.
Verständnis hilft, nicht Kontrolle
Bei der Therapie wird zuerst einmal geschaut, welche Funktion das Ritzen für den Betroffenen hat. "Sie können nicht erwarten, dass jemand etwas aufgibt, was für ihn wichtig ist", sagt Kaess. Warum machst Du das? Was kann man tun, damit es nicht mehr nötig wird? Mit solchen Fragen gelte es erst einmal, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Diene das Ritzen dazu, die Gefühle zu regulieren und sich selbst wieder zu spüren, könne man es erst einmal teilweise ersetzen: "Etwa durch eine Chilischote", sagt Kaess. Damit lassen sich ebenfalls starke Sinnesreize hervorrufen, aber ohne, dass ich mir körperlich schade." Häufig sei es auch hilfreich, daran zu arbeiten, besser mit Druck und Problemen umgehen zu können, so der Mediziner. Sind Beziehungen zu anderen Menschen belastend, gelte es, diese zu verbessern.
Entdecken Eltern, dass ihr Kind sich ritzt, ist die Panik oft groß. Viele reagieren enttäuscht, anklagend und wütend. Das sei verständlich, sagt Kaess. Er rät ihnen trotzdem dazu, Ruhe zu bewahren und professionelle Hilfe aufzusuchen. "Wichtig ist es, nicht anzuklagen und nicht zu werten", sagt er. "Das verstärkt das schädigende Verhalten." Vielmehr sei es ratsam, zu fragen und ernsthaft verstehen zu wollen: Welche Probleme gibt es? "Auch wenn ein typisch pubertierender Jugendlicher erst einmal keinen Bock hat, darauf zu antworten, sollten Sie geduldig bleiben", sagt Kaess. "Ein wertschätzendes Interesse an sich und ihren Problemen nehmen Jugendliche durchaus wahr."
Jugendliche bis in ihre Privatsphäre zu kontrollieren, davor warnt der Mediziner. "Manche Eltern verbieten ihren Kindern, die Badezimmertür abzuschließen, sie räumen sämtliche Messer und Rasierklingen weg und lesen Tagebücher. Das hilft nicht. Es verstärkt den Stress und das Verhalten eher noch. Einen jungen Menschen, der sich selbst verletzen will, werden sie davon nicht abhalten", sagt Kaess. Auch wenn es schwerfällt, Verständnis, Geduld und eine Therapie bringen weiter.
Lilly Lindner ist bis heute nicht zurück in ihren Körper gekehrt. Er ist noch immer etwas, das sie mehr von außen betrachtet. Heute braucht Lilly aber keine Rasierklingen mehr, um sich selbst zu spüren und ihre Schmerzen greifbar zu machen. "Ich habe dafür jetzt Worte", sagt sie.
In einem Jahr schrieb sie 15 Bücher, fünf hat sie bereits veröffentlicht. Sie sei wie in einem Wahn, wenn sie schreibt. Wenn sie all die Worte, die ihr unentwegt durch den Kopf schwirren, auf Papier bringt, bis ihr die Finger vom Schreiben wehtun. Zwar sehnt sie sich manchmal noch immer danach, einfach zu verschwinden. Aber anders als früher kann sie heute damit umgehen. Sie sagt, dass die Worte sie retten.
Ich wollte ausdrücken, wie es sich anfühlt, abseits von seinem Körper in fremden Vorgärten zu stehen und zu beobachten, wie die Zeit davonrennt. Ich wollte von Schönheit schreiben, von Glück, von der lautesten Stille, von der hässlichsten Berührung. Ich wollte meine sanftmütigen Gefühle direkt neben meine eiskalte Ausdruckslosigkeit stellen, und erzählen, von einem Schmerz, der so groß ist, dass man ihn sich in die Haut schneiden muss, um zu begreifen, wie real er ist. Ich wollte erklären, was es bedeutet, sich Ana zu nennen, obwohl man ganz genau weiß, dass Magersucht kein passender Name für ein Dasein ist, eher für ein Wegsein. Ich wollte, dass jemand meine Worte liest und einen Moment lang verharrt, in diesem Bild, das ich von mir gezeichnet habe, auch wenn ich mich nicht sehen kann.
(Lilly Lindner, "Winterwassertief")