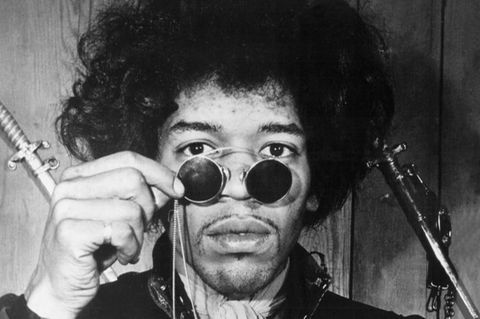Von Tobias Schmitz
Sie hatten sich lange genug selbst betrogen. Hatten sich vorgemacht, alles würde seinen gewohnten Gang nehmen. Björn und Benny würden einen Nummer-eins-Hit schreiben und dann Agnetha und Frida ins Studio holen. Agnetha würde den Solopart singen und Frida sich dezent zurückhalten. Später würden sie ein paar Interviews geben, ein Video produzieren, lächeln und sagen, mit Abba sei alles in Ordnung. Aber nichts war in Ordnung, schon lange nicht mehr.
Björn und Agnetha hatten sich geliebt und waren gescheitert. Benny und Frida hatten sich geliebt und waren gescheitert. Sie hätten sich längst trennen können. Aber sie blieben und waren tapfer, unglaublich tapfer. Verbargen Erschöpfung unter dicker Schminke, bekämpften die Leere mit jenem Dauerlächeln, das mit jedem Tag dieses Jahres 1982 immer mehr zur Maske wurde.
Zehn Jahre lang hatten sie um Perfektion gekämpft, gegen Neid und Missgunst und hämische Journalisten - jetzt waren sie müde. Und dann ging plötzlich alles ganz schnell: 20. August 1982, Polar-Studio, Stockholm, Abbas letzte Aufnahme. »The Day Before You Came« war todtraurig, Lichtjahre entfernt von dieser unglaublichen Lebensfreude, die »Dancing Queen« zum vielleicht besten Popsong aller Zeiten gemacht hatte. 21. September 1982, Stockholm, das letzte Video zur letzten Aufnahme: Agnetha schleicht einsam über einen verregneten Bahnsteig. »The Day Before You Came« schaffte es in England gerade auf Platz 32. Ein Desaster.
Ein paar Monate später war Abba einfach weg. Verschwunden vom Pop-Planeten, der ihnen fünf, sechs Jahre lang erlegen war. Und niemand schien Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog und Anni-Frid »Frida« Lyngstad wirklich zu vermissen. »Abba macht nur eine Pause«, war die offizielle Sprachregelung.
Die Pause dauerte knapp zehn Jahre. Dann nahmen die englischen Elektronik-Popper von Erasure 1992 ein paar Abba-Stücke neu auf und leiteten damit die Renaissance der Schweden ein. Ungläubig starrten die vier in ihren Landsitzen und Anwesen auf die Verkaufslisten: Das Album »Abba Gold«, eine Zusammenstellung der größen Hits, katapultierte die Band ein Jahrzehnt nach der letzten Single weltweit zurück an die Spitze der Charts und verkaufte sich seitdem mehr als 20 Millionen Mal. Das Revival ging weiter, auch im Kino mit Filmen wie »Muriels Hochzeit« oder »Priscilla, Queen of the Desert«. Seit Beginn ihrer Karriere hat die Gruppe schätzungsweise 350 Millionen Alben verkauft, jeden Tag gehen weitere 3600 über die Ladentische dieser Welt.
Im April 1999 feierte in London das Musical »Mamma Mia!« Premiere, das auf 22 Abba-Hits basiert und inzwischen auch erfolgreich in Australien, den USA und Kanada läuft. Der Vorhang für die deutsche Version von »Mamma Mia!« hebt sich am 3. November im Operettenhaus Hamburg. Für die erste nicht englischsprachige Produktion wurde das ehemalige »Cats«-Theater für rund neun Millionen Euro umgebaut. Mehr als 100.000 Eintrittskarten für das Musical sind bereits verkauft - Rekord. Dabei ist »Mamma Mia!« keineswegs die vertonte Geschichte der Popgruppe, sondern ein eigenständiges Stück um ein junges Mädchen, das unter drei verschiedenen Männern seinen Vater herausfinden muss.
Zusammengehalten wird das Ganze durch die Songs, die der deutsche Komponist und Texter Michael Kunze geschickt ins Deutsche übertragen hat. Schon die Abba-Originaltexte waren oft banal bis zur Schmerzgrenze - zumindest zu Anfang ihrer Karriere. Und nun das Ganze auf Deutsch? »Das Publikum wird nach zehn Minuten vergessen, dass die Texte nicht auf Englisch sind«, prophezeit Björn Ulvaeus. »Mamma Mia!« ist ein schrilles Pop-Märchen, fröhlich und knallbunt mit einem Live-Sound, der das Publikum aus den Sitzen haut. Das 37-köpfige Ensemble könnte zu Björn und Bennys Musik auch das Telefonbuch der Hansestadt vorsingen, der Klangzauber bliebe derselbe.
Die einzigartigen Melodien waren das Resultat einer Partnerschaft, die vor 36 Jahren begann. Es geschah auf einer Party in Linköping: Björn Ulvaeus, musikalischer Kopf der Skiffle-Band Hootenanny Singers, trank Bier mit Benny Andersson, Keyboarder der Hep Stars, einer Art schwedischer Beatles. »Wir mussten uns einfach treffen«, sagt Björn heute, »wir waren wesensverwandt.« Benny hatte 1966 für die Hep Stars seinen ersten Hit geschrieben. »Vorher wusste ich nicht, ob ich Taxifahrer, Tischler oder sonst was werden sollte.« Statt Taxi zu fahren, traf sich Andersson immer häufiger mit Ulvaeus, und beide planten eine gemeinsame Karriere als »Björn & Benny«. Dann führte sie das Schicksal zu Agnetha und Frida.
Agnetha Fältskog, dieser blonde Traum aus gutem Hause und gefeierte Solostar, stand Ende der 60er regelmäßig an der Spitze der schwedischen Charts. Björn traf sie im Mai 1968 bei einem Konzert in Smaland. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ähnlich wie bei Benny und Frida, die sich im März 1969 auf einer Party begegneten.
Anni-Frid »Frida« Lyngstad hatte es immer viel schwerer als Agnetha gehabt: 1945 im Norden Norwegens als uneheliche Tochter der damals 19-jährigen Synni Lyngstad und des deutschen Soldaten Alfred Haase geboren, war Frida das Baby einer Ausgestoßenen. Haase hatte Synni noch vor Fridas Geburt verlassen, angeblich ohne zu wissen, dass er Vater werden würde.
Als ruchbar wurde, dass Frida Kind eines »Nazi-Deutschen« war, musste Fridas Mutter ihr Dorf verlassen. Einsam und innerlich gebrochen starb Synni zwei Jahre später mit 21 Jahren. Frida wuchs bei ihrer Großmutter in Schweden auf. Erst 1977 erfuhr sie durch eine findige »Bravo«-Leserin, wo ihr Vater - noch heute - lebt: in Karlsruhe.
Auch Frida hatte sich vor Abba als Sängerin versucht, jedoch längst nicht den Erfolg von Agnetha gehabt. Hätte sie Benny Andersson nicht kennen gelernt, sie hätte wohl aufgegeben und eine Ausbildung zur Kostümbildnerin begonnen.
Im August 1969 verloben sich Benny und Frida, acht Monate später dann auch Agnetha und Björn. Unter dem Namen »Festfolk« erleben sie 1970 erste gemeinsame Auftritte, die kabarettähnliche Züge tragen.
Als Björn und Agnetha am 7. Juli 1971 heiraten, spielt Benny den Hochzeitsmarsch. 1972 folgt der erste gemeinsame Song »People Need Love«, veröffentlicht unter dem Namen »Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid«. Ein Jahr später nehmen sie unter diesem Namen an der schwedischen Ausscheidung zum »Grand Prix Eurovision de la Chanson« teil. Die erzkonservative Jury setzt »Ring Ring« nur auf den dritten Platz. Das Publikum ist darüber so aufgebracht, dass das Gremium im darauf folgenden Jahr durch ein Zuschauervotum ersetzt wird. Und damit ist der Weg zur Weltkarriere frei.
Brighton, 6. April 1974, Grand Prix, Finale. Manager Stig Anderson, ein ehemaliger Grundschullehrer, hat den Auftritt mit »Waterloo« wie einen Feldzug geplant. Alles sollte anders sein: Die Gruppe hat endlich einen einprägsamen Namen, zusammengesetzt aus den Initialen der vier Vornamen. Abba spielt Rock, Abba hat zwei gleichberechtigte Sängerinnen, Abba trägt diese unglaublichen Kostüme: Björn steht auf Plateausohlen und spielt auf einer sternenförmigen Gitarre. Agnethas hellblaue Satinhose ist so eng, dass sich die Blonde während des ganzen anstrengenden Abends kein einziges Mal hinsetzen kann.
»Waterloo« siegt und erobert Europa im Sturm. Trotzdem halten Musikkritiker und Plattenbosse Abba für eine typische Eintagsfliege. Erst »S.O.S.« führt die Gruppe 18 Monate nach »Waterloo« zurück zum Erfolg. Und mit »S.O.S.« hatten Björn und Benny den Schlüssel für eine märchenhafte Karriere gefunden: ihren eigenen Sound.
Nicht durch Zufall, sondern durch harte Arbeit: Benny sitzt am Klavier, entwickelt eine Idee, die Björn mit der akustischen Gitarre aufgreift, weiterspinnt und mit einem provisorischen Text an seinen Partner zurückgibt. Sechs bis acht Stunden pro Tag, drei Wochen lang, dann ist - vielleicht - ein neuer Song fertig. Oft aber auch nur eine Nummer für den Papierkorb.
Was diesen Musikdarwinismus überlebt, wird im Studio mit Toningenieur Michael B. Tretow auf Hochglanz poliert. Abbas Zauberformel für perfekten Pop: Die Melodie muss so einfach und der Sound so raffiniert wie möglich sein. Agnetha ist ein Sopran, Frida singt als Mezzosopran etwas tiefer. Tretow mischt die beiden Stimmen, wendet einen Haufen technischer Tricks an, und nach vielen aufreibenden Wochen ist er fertig, der neue Hit. Wie immer haben Agnethas und Fridas Stimmen dieses Strahlen, dieses Glitzern, das die Menschen glücklich macht. Und wie immer sind alle Beteiligten mit den Nerven am Ende.
Es entsteht Welthit auf Welthit: Nach »S.O.S.« folgt »Mamma Mia«, dann »Fernando«, schließlich »Dancing Queen«. Frida weint angeblich vor Freude, als ihr Freund Benny ihr den Song zum ersten Mal vorspielt. Die Popularität der Gruppe nimmt die beängstigenden Züge einer »Abbamanie« an: 1977 stehen für zwei Konzerte in der Londoner Royal Albert Hall 11.000 Tickets zur Verfügung - 3,5 Millionen Bestellungen treffen ein. In Australien löst eine Sendung über Abba die Live-Übertragung der ersten Mondlandung als meistgesehenes TV-Ereignis ab. Die erste Australien-Tournee von Abba 1977 gerät beinahe außer Kontrolle: Für einen Blick auf ihre Idole werfen sich Mütter mit ihren Kindern vor die Wagenkolonne, die Abba zum Flughafen bringt.
Manager Stig Anderson reibt sich die Hände: Mit an Besessenheit grenzendem Fleiß tingelt er durch die Welt, handelt für jedes Land Plattenverträge aus, die ihm und Abba maximalen Profit garantieren. Nebenbei erfindet die Gruppe das Musikvideo: Weil sie nicht überall gleichzeitig auftreten können, verschicken sie eben Videobänder. Lasse Hallström, heute einer der großen Regisseure Hollywoods, darf sich an den Abba-Videos austoben und dreht auch den Kinofilm der Gruppe mit weitgehend sinnfreier Handlung, aber vielen Bildern von der Australien-Tournee.
Doch auch die schönsten Bilder können nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Leben in Tonstudio, Flugzeug und Hotel seinen Tribut fordert. Zwischen Agnetha und Björn kriselt es. Agnetha sehnt sich nach ihren kleinen Kindern Linda und Christian und will lieber Mutter als Megastar sein. Reisen ist für sie eine Qual, weil sie unter Flugangst leidet. Björn genießt den Ruhm und merkt nicht, wie sehr seine Frau leidet. Zugunsten der Familie zurückzustecken kommt für ihn nicht infrage.
Weihnachten 1978 zieht Agnetha nach der Bescherung aus dem gemeinsamen Haus aus. Abbas perfekte Oberfläche bekommt Risse - paradoxerweise tut das der Gruppe gut, weil Björns Texte nun Tiefe bekommen und Erfahrungen wie Schmerz und Trauer in die Songs fließen.
Nicht nur private Probleme zerren an den Nerven: Mit ihren legendären Kostümen und ihrem Image makelloser Großverdiener wird Abba in der Musikbranche zum Ziel von Verachtung und Spott. »Damals hätten wir Abba am liebsten geköpft, und ich hätte dabei die Axt geschwungen«, sagt U2-Sänger Bono heute, »wir haben gar nicht bemerkt, dass hier eine der besten Popgruppen aller Zeiten heranwuchs.« Und Malcolm McLaren, Manager der Sex Pistols, bemerkt rückblickend: »Abba stand für alles, was man nicht leiden konnte. Der Gedanke, dass Mum und Dad diese Melodien im Badezimmer ihres Vorortheims pfiffen, brachte einen sofort in Opposition!«
Selbst in Schweden wetzten die Kritiker die Messer: Abba verdiente gewaltige Summen, war profitabler als Volvo und versuchte dennoch alles, um sich vor der für Spitzenverdiener üblichen Einkommensteuer von 85 Prozent zu drücken. Im sozialdemokratischen Schweden der 70er Jahre eine Todsünde. Stig Anderson investierte, um Steuern zu sparen, in alle möglichen - und unmöglichen - Projekte und Firmen. Bald gehörten Abba Supermärkte, Bürotürme und Investmentfirmen, sie handelten mit Kunst und Sportbekleidung. Aus der Popgruppe war Ende der 70er ein Mischkonzern geworden, der unter anderem mit Rohöl spekulierte - ausgerechnet die gleichnamige Fischfirma hatte mit Abba nie etwas zu tun.
Doch Stig Anderson richtete Abbas schwer zu durchschauendes Firmenimperium zugrunde und bescherte der Gruppe horrende Verluste. In den letzten Jahren seines Lebens sprach er mit dem Quartett fast nur noch über Anwälte. Der Mann, der aus dem Nichts kam und einer der reichsten Männer Schwedens wurde, starb erschöpft und alkoholkrank 1997 nach einem Herzanfall. Als wäre der König gestorben, wurde seine Beerdigung live im schwedischen Fernsehen übertragen - eine späte Reverenz.
Als »The Day Before You Came« 1982 sang- und klanglos aus den Charts verschwand, war klar: Abba hatte sich musikalisch von seinem Publikum entfernt. »Eigentlich logisch«, sagt Björn heute, »Popmusiker können den Nerv der Zeit immer nur für eine gewisse Dauer treffen. Außerdem wollten wir nach so vielen Jahren einfach etwas anderes machen.«
Frida und Agnetha nahmen wenig erfolgreiche Soloalben auf, Benny und Björn schrieben gemeinsam mit Tim Rice das Musical »Chess«, das in England zufriedenstellend lief, in Amerika jedoch floppte. Ein zweites folgte 1995: »Kristina fran Duvemala«, die Geschichte schwedischer Amerika-Emigranten. Im Heimatland der Autoren war es sehr erfolgreich, die englische Version ist in Planung.
Nach dem Ende ihrer Solokarriere kämpfte Agnetha immer wieder mit Einsamkeit und Depressionen. Heute lebt die 52-Jährige zurückgezogen auf der Stockholmer Insel Ekerö. Ihr Resümee klingt bitter: »Ich habe nie ein Weltstar werden wollen.«
Der Trennung von Björn Ulvaeus folgten mehrere Beziehungen, die im Chaos endeten. Die zum Niederländer Gert van der Graaf, der sich als Achtjähriger in die Blonde verliebt hatte und mit dem sie von 1997 bis 1999 eine Affäre hatte, endete sogar vor Gericht. Als Agnetha Schluss machte, drehte er durch und terrorisierte Fältskog so lange mit Briefen und Anrufen, bis sie ihn verklagte. Die schwedische Boulevardpresse jubelte.
Frida war mit der Abba-Karriere stets besser zurecht gekommen. Ihr Glück fand sie an der Seite des deutschen Prinzen Ruzzo Reuß, eines Architekten, der aus dem verstoßenen Mädchen Anni-Frid Lyngstad 1992 eine echte Prinzessin machte. Doch das Märchen endete ebenfalls tragisch: 1999 starb Reuß an Krebs. Erst ein Jahr zuvor war Fridas 30-jährige Tochter Lise-Lotte bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Heute lebt Frida, 56, vorwiegend in der Schweiz und sagt: »Ich habe gemerkt, dass ich eine sehr starke Frau bin.«
1981 war Frida Knall auf Fall von Benny verlassen worden - für Mona Nörklit, mit der Andersson in einer Villa im vornehmen Stockholmer Stadtteil Djurgarden lebt. Heute spielt Benny, 55, ausschließlich schwedische Volksmusik und tourt im Sommer mit anderen Musikern durchs Land. Die anhaltende Abba-Euphorie macht ihn skeptisch: »Natürlich bin ich stolz, aber ist es nicht irgendwie seltsam, dass solche Erfolge durch etwas erreicht werden, das vor 20 Jahren geschaffen wurde?«
Auch Björn Ulvaeus, 57, in zweiter Ehe seit 1981 mit der Schwedin Lena Källersjö verheiratet, lebt wieder in Stockholm. Er hat die Schöpfer von »Mamma Mia!« beraten und reist in dieser Funktion noch immer als Abba-Botschafter um die Welt.
Wenn am 3. November in Hamburg der Vorhang für »Mamma Mia!« aufgehen wird, ist es 36 Jahre her, dass Björn und Benny ein paar Bier zusammen tranken. Noch immer betteln Abba-Fans auf der ganzen Welt, die Gruppe möge wieder zusammenkommen. Noch immer erkennen wildfremde Menschen Björn auf der Straße, schütteln ihm die Hand, lächeln und und murmeln ein verhuschtes: »Thank you for the music, Sir!«
Ein Unternehmer bot vor zwei Jahren eine Milliarde Dollar für eine letzte Abba-Tour - alles vergebens. Björn Ulvaeus sagt: »Die Leute sollten uns so in Erinnerung behalten, wie wir einmal waren.«