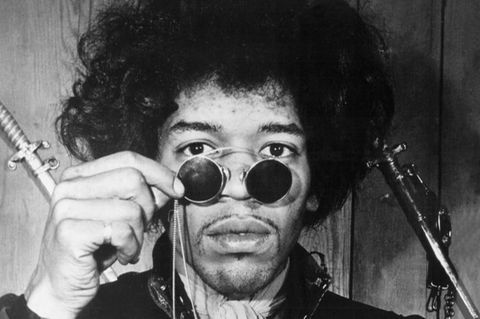Über kaum einen Komponisten gibt es derart viele Vorurteile wie über Richard Wagner. Er stand als demokratischer Revolutionär auf den Barrikaden von 1848, schwang die schwarz-rot-goldene Fahne und verdingte sich danach ohne Bauchschmerzen bei Märchenkönig Ludwig II. Er war Freund und Intimfeind des Philosophen Friedrich Nietzsche, inspirierte George Bernhard Shaw und Thomas Mann. Wagner war Hitlers Lieblingskomponist und ist zum vielschichtigen deutschen Musiker-Mythos gewachsen. Noch heute begeistern seine Werke das Land und seine Stellvertreter. Wenn Angela Merkel alljährlich zu den Bayreuther Festspielen pilgert, wird ihr der rote Teppich auf dem "Grünen Hügel" ausgerollt.
Tatsache ist, dass die Werke Wagners sich einem breiten Interpretationsspektrum öffnen. Die Gesamtkunstwerke legitimieren die sozialistische Theorie Marx' ebenso wie faschistoide Mutterlandphantasien - gleichzeitig steht Wagner aber auch für die Wiederbelebung der antiken Ideale von Gleichheit, Gerechtigkeit und Demokratie.
"Sternstunden der Oper"
Die komplette, zehn DVDs umfassende Edition "Sternstunden der Oper" können Sie für 129 Euro im stern-Shop bestellen.
Mit dem Bayreuther Festspielhaus wollte der Komponist ein Opernhaus für alle gründen. Ein Theater, dessen Gesamtkunstwerk in der Gleichzeitigkeit von Schauspiel, Musik, Text und Kunst begründet lag. Ein Haus, dessen Erzählraum, die Bühne, sich der Gesellschaft öffnen sollte. Für Wagner waren die Künstler die eigentlich treibenden Kräfte eines Staates, von ihnen gingen die revolutionären Inspirationen aus. Seine Opern plädieren dafür, dass Bühne und Welt nicht länger voneinander zu trennen sind.
Es ist anzunehmen, dass Wagner für seinen Mittelalter-Minnesänger Tannhäuser ein besonderes Faible entwickelt hat. Denn der ist ebenso unkonventionell wie der Komponist selbst. Ein Künstler, der in einem Zwiespalt aus Erotik und heilige Messe gefangen ist, in dessen Herzen zwei Seelen um Befriedigung buhlen: die fleischliche Lust und die religiöse Leidenschaft. Ein Künstler, dem es leicht fällt, Konventionen zu ignorieren.
Müde von der andauernden höllischen Erregung
Tannhäuser flieht aus dem Reich der Liebesgöttin Venus, da er müde von der andauernden höllischen Erregung ist. Zurück in der Welt des Mittelalters trifft er die gläubige Elisabeth und beschließt, für sie in einem Sängerwettstreit die Stimme zu erheben. Doch seine Ode gerät zum Hohn der konventionellen Minne. Er singt ein flammendes Plädoyer für die Lust des Fleisches - eine Liebeserklärung an die Liebesgöttin Venus. Tannhäuser wird von seinen Mitstreitern vertrieben und geächtet. Eine Pilgerreise nach Rom soll sein Seelenheil retten. Doch auch der Papst verweigert dem Sünder die Absolution - erst wenn sein Hirtenstab Blüten tragen würde, wäre Tannhäuser gerettet. Eine aussichtslose Prophezeiung.
Der Minnesänger hadert damit, zurück in Venus' Schoß zu kehren, bis der Gedanke an Elisabeth ihn abhält. Was er nicht weiß: die Geliebte ist bereits gestorben. Auch Tannhäuser stirbt an gebrochenem Herzen. Nach seinem Tod verkünden Pilger, dass der Stab des Papstes Blätter trägt. Wie immer bei Wagner werden die Liebenden erst im Tode erlöst.
Waltraud Meier als erotisch flirrende Venus
In fast all seinen Opern bildet das romantisch verklärte Mittelalter für Richard Wagner lediglich den Schauplatz, um aktuelle Gesellschaftskritik zu üben. Mit seinen Werken rüttelt er an überkommenen Konventionen und der weltlichen Unmöglichkeit, seine individuellen Ideale zu leben. Regisseur David Alden inszeniert seinen Münchener "Tannhäuser" deshalb auch als Spiegel der deutschen Seele: Vor einer gigantischen Betonwand mit der Aufschrift "Germania" lässt er seinen Helden aus dem Leben in eine bessere Welt scheiden. René Kollo interpretiert einen zerrissenen Tannhäuser und beweist, dass bei Wagner die Wortverständlichkeit und die Geste des Gesangs den Charakter ausmachen. Waltraud Meier gibt die erotisch flirrende Venus und Nadine Secunde ihren Gegenpart, die lyrisch transzendente Elisabeth.
Dieser "Tannhäuser" ist der Beweis, dass Richard Wagners Opern gerade von ihren Mythen leben und dennoch eine ganz eigene, zutiefst sinnliche Musiksprache pflegen: ein deutsches Gesamtkunstwerk, an dem sich die Nation noch viele Generationen lang abarbeiten wird.