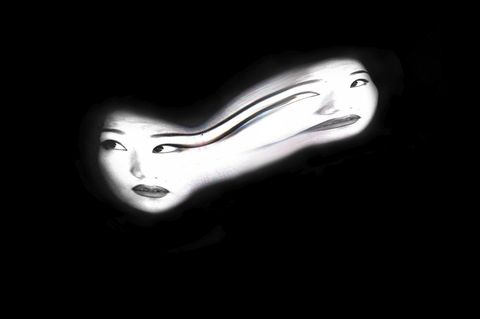Richard Kim trägt seit elf Monaten jeden Tag dieselbe Jeans und hat sie noch nie gewaschen. Er will herausfinden, wie dieser Hosenstoff altert und ausbleicht, wie Schweiß, Bewegungen und Sonne auf das Gewebe wirken. Kims Frau nimmt es klaglos hin, dass ihr Mann mit ungewaschenen Hosen zur Arbeit geht, schließlich verdient er sein Geld mit solchen Experimenten.
Kims Firma International Garment Finish (IGF) ist eine von etwa zwei Dutzend Fabriken weltweit, die sich auf das Waschen, Abscheuern, Zerreißen, Flicken, Ausmergeln und Besticken von Jeans spezialisiert haben. 260 Mitarbeiter "veredeln" bei IGF Hosen für Auftraggeber wie DKNY, Armani Exchange, Juicy Couture und Abercrombie & Fitch. Die dunkelblauen Rohlinge kommen aus China und Mexiko; bei IGF in Kalifornien werden sie bearbeitet und dann an Einzelhändler ausgeliefert. Täglich 10000 Stück.
Noch einen Monat will Kim seine Hose tragen - denn nur ein Langzeitversuch kann genaue Erkenntnisse liefern über Faltenwürfe und Abschürfungen. Die Kollegen bei IGF werden dann die Muster im Stoff studieren und versuchen, sie nachzuahmen - mit Hilfe von neuartigen Waschverfahren, Lasern, Bürs-ten und Schleifmaschinen.
Von außen
ist der Fabrikhalle in einem heruntergekommenen Industriegebiet von Long Beach nicht anzusehen, dass hier ein erfolgreiches Modeunternehmen auf Hochbetrieb läuft. Während sich der Rest der Branche seit Jahren mühsam dahinschleppt, boomt der Jeansmarkt auf der ganzen Welt. In Deutschland stieg der Umsatz in diesem Segment im Jahr 2004 um drei Prozent - während die Bekleidungsindustrie insgesamt um zwei Prozent schrumpfte. In anderen Ländern sind die Zuwachsraten noch höher: Die Briten etwa werden dieses Jahr 56 Prozent mehr Geld für Jeans ausgeben als noch 2000. Richard Kim trägt diese Zahlen auswendig vor. 1986 gründete er IGF, und noch nie liefen die Geschäfte so gut wie heute.
Seine Firma profitiert vom erstaunlichsten Modetrend des Jahrzehnts: Die Jeans, einst ein Kleidungsstück für Arbeiter, Fußballtrainer und Kleingärtner, entwickelte sich zum Statussymbol für Betuchte. Wer zum feinen Dinner eingeladen ist oder zu einer Hochzeit auf Sylt, erscheint in Jeans. Die Labels heißen Seven for All Mankind, Blue Cult, Evisu, Parasuco, Rock & Republic, Citizens of Humanity oder True Religion, und viele von ihnen stammen aus dem Großraum Los Angeles.
Die Marke "Seven for All Mankind" gilt als Vorreiter der Premiumwelle: Im Jahr 2000 gründete der Modemanager Peter Koral zusammen mit zwei befreundeten Friseuren die Firma. Ihnen gelang es, dass sich Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow und Kylie Minogue die Jeans mit der perfekten Passform überzogen. Die Schauspielerinnen wiederum ließen voller Selbstbewusstsein ihre Hinterteile von Paparazzi fotografieren. Im vorigen Jahr setzte Seven for All Mankind 200 Millionen Dollar um. Auch für die Marke True Religion macht sich die neue Liebe der Stars zu straffem Denim bezahlt: Seit Cameron Diaz und Angelina Jolie in diesen Hosen auf Filmpremieren auftauchen, hat sich der Jahresumsatz auf 27,7 Millionen Dollar hochgeschraubt.
"Wenn die Hose gut sitzt und der Kundin die Waschung gefällt, gibt es beim Preis keinen Widerstand", sagt Suzy Radcliffe, Designerin des gleichnamigen Londoner Luxus-Jeans-Labels. Man könnte es auch andersrum formulieren: Ist die Hose zu günstig, will niemand sie haben. Das Logo am Po verrät schließlich, wie viel Geld das Teil gekostet hat. Bei Radcliffe kann der Preis 300 Euro locker überschreiten.
Längst drängen auch
die traditionellen Hersteller wie Wrangler, Lee, Levi's und Diesel ins Geschäft mit den Hochpreis-Jeans. Levi's bietet eine limitierte Neuauflage der ersten 501 von 1886 an - zum Preis von 501 Euro. Heiner Sefranek, Chef bei Mustang Jeans, beschreibt das Phänomen in Deutschland: "Der Trend zur hochpreisigen Jeans ist die Gegenbewegung zur "Geiz ist geil'-Entwicklung." Deswegen verkauft seine Firma nun Hosen zu Preisen von über 100 Euro. Das Label heißt For personal use. Til Schweiger hat beim Design mitgeholfen.
Die Wünsche der Jeans-Käufer werden immer ausgefallener: Löcher an Knien und Hintern sollen ausgefranst wirken, aber nicht einreißen; eine neue Hose muss so aussehen, als habe ihr Besitzer sie bereits hundertmal gewaschen; Öl- und Schmutzflecken dürfen nicht zu aufdringlich angebracht sein; zusätzlich erwarten die Kunden Flicken, Bestickungen, Strass. "Wer 200, 300, 600 oder mehr Dollar für eine Jeans bezahlt, will natürlich ein perfektes Produkt", sagt Richard Kim. Er fertigt nur noch halb so viele Hosen wie 1998 - und benötigt dafür doppelt so viele Mitarbeiter.
Von Kims Büro aus führt eine Tür in die Waschküche. Hier werden die rohen Jeans palettenweise von Gabelstaplern angekarrt und in die sechs Meter hohen Waschtrommeln geworfen. Sobald die Hosen aus der ersten Wäsche kommen, wird es kompliziert: IGF verarbeitet 600 verschiedene Modelle, die später in Preisklassen von 40 bis 1000 Dollar verkauft werden. In einem Raum spannen Mitarbeiter die Hosen auf künstliche Beine und reiben mit Schmirgelpapier die Knie ab; nebenan schleifen sie Löcher in die Oberschenkel; in einer dritten Halle werden die Hosen mit Säure beträufelt und gefaltet - sodass im Schritt Knittereffekte entstehen.
Für IGF laufen die Geschäfte prächtig, auch weil die Firma den Ruf hat, technisch auf dem letzten Stand zu sein. Die Produktion einer Jeans in Billiglohnländern kostet etwa fünf Dollar, ihre Veredelung in Kalifornien oder Norditalien noch einmal zwischen 5 und 15. Im Laden sind die Teile oft für das Zwanzigfache zu haben - kein anderes Segment der Oberbekleidung bietet solche gewaltigen Gewinnspannen. Seit diesem Sommer verkauft das New Yorker Label A.P.O. Jeans ab 4000 Dollar - aus handgewebtem indischem Denim und mit Knöpfen aus 48-Karat-Diamanten. A.P.O. übertrifft damit die Firma Gucci, die laut "Guiness Buch der Rekorde" die teuerste Jeans der Welt für 3134 Dollar im Angebot hatte. Doch das war 1998.
Für Richard Kim
ist dieses hysterische Umfeld der Premium-Jeans Segen und Fluch zugleich. Seine Arbeit besteht darin, den Kunden die Hosen so herzurichten, dass sie trotz des herrschenden Überangebots auffallen und gekauft werden. Da die Konkurrenz den gleichen Plan hat, muss Kim seine Technik stets weiter aufrüsten. Klar, dass die neuesten Verfahren für eine Waschung oder eine bestimmte Faltenwurftechnik von den Veredlern so geheim gehalten werden wie sonst nur das Rezept von Coca-Cola.
Im Archiv von IGF hängen einige tausend Hosen, die Mitarbeiter auf allen Kontinenten auf Flohmärkten, in Boutiquen und Second-handläden zusammengetragen haben. David Johnson, der Leiter der Abteilung Research & Development, sagt: "Ich habe jede Hose studiert und kann jeden Effekt im Stoff nachahmen. Aber das reicht heute nicht mehr, denn das können die anderen auch. Wir müssen jeden Tag mit neuen Ideen kommen. Und wir müssen die Effekte in großen Stückzahlen umsetzen können."
Johnson steht in seinem Labor, das aus einem Dutzend Waschbecken, aus Bügelbrettern sowie einem Arsenal an Heimwerkerutensilien besteht, und schleift mit einer Maschine an einer Jeans herum. "Manchmal lege ich eine Hose über Nacht in Säure und kann am Morgen gar nicht schnell genug zur Arbeit kommen, um herauszufinden, ob der Effekt brauchbar ist", sagt er.
Auf der anderen Seite der Straße hat Richard Kim eine Halle errichten lassen, in der er die bislang größte Investition der Firmengeschichte untergebracht hat. Zwei Roboter können mit Lasern jedes gewünschte Wasch- oder Knittermuster in jeden beliebigen Stoff einbrennen. "Die Laser-Effekte werden in den nächsten Jahren das große Ding sein", sagt Kim und weist stolz auf einen Mitarbeiter, der eine dunkelblaue Hose auf zwei Gummibeine spannt. Die Glastür schließt sich, der Roboter richtet den Laser auf den Stoff. Rauch steigt auf, die Hose fällt von den Gummibeinen und sieht aus wie vollkommen verwaschen. Auf dem Label steht: True Religion.
Irgendeine Frau wird für dieses Meisterwerk der kunstvollen Zerstörung bald mehr als 400 Dollar bezahlen. Richard Kim findet das vollkommen angemessen.