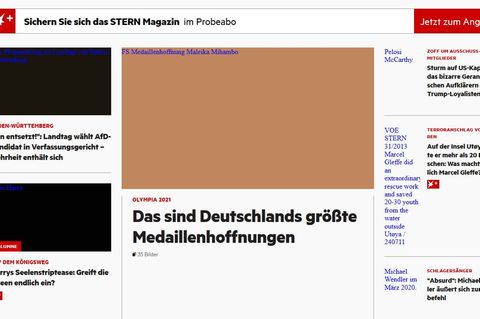Die so eingestuften Konzerne müssen unter anderem stärker gegen Falschinformationen vorgehen und die Algorithmen hinter ihren Inhalten und personalisierter Werbung zum Teil offenlegen. Hassrede und Falschinformationen sollen sofort gelöscht werden. Halten sie sich nicht daran, drohen Geldstrafen.
Das Gericht erklärte nun, dass Zalando zwar mit Blick auf den Verkauf eigener Produkte keine Online-Plattform sei. Allerdings gibt es ein sogenanntes Partnerprogramm, mit dem andere Verkäufer über die Seite Waren vertreiben. In der Hinsicht sei Zalando eine Plattform.
Als Schwelle für eine sehr große Online-Plattform gilt die Zahl von mehr als 45 Millionen aktiven Nutzern in der EU pro Monat. Die Kommission gab bei ihrer Einstufung im April 2023 an, dass Zalando mehr als 83 Millionen solcher aktiven Nutzer habe.
Zalando machte geltend, dass die Schwelle nicht überschritten sei. Das Unternehmen konnte aber nicht zwischen jenen Nutzern unterscheiden, die im Rahmen seines Partnerprogramms Informationen von Drittverkäufern bekamen, und den anderen, wie das Gericht ausführte. Die Kommission sei also zu Recht von einer so hohen Zahl aktiver Nutzer ausgegangen.
Zalando hatte auch argumentiert, dass das neue Gesetz gegen die Grundsätze der Rechtssicherheit, der Gleichbehandlung und der Verhältnismäßigkeit verstoße. Das sah das Gericht aber anders. So große Online-Marktplätze könnten benutzt werden, um den Vertrieb gefährlicher oder rechtswidriger Produkte an einen erheblichen Teil der EU-Bevölkerung zu erleichtern, erklärte es.
Zalando kann gegen die Entscheidung noch vor der nächsthöheren Instanz, dem Europäischen Gerichtshof, vorgehen.