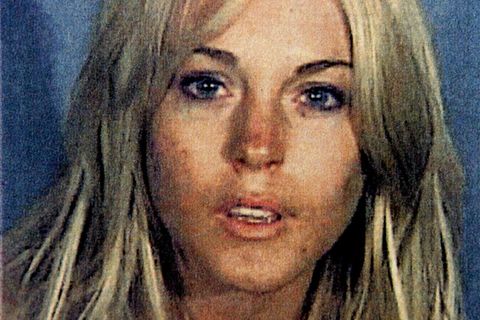Die Katastrophe geschah am frühen Morgen. Mariko Yoshikawa war gerade in Tokio auf dem Weg zu einem Seminar, als sie plötzlich in der U-Bahn Saringas einatmete. Es war der 20. März 1995. Die Endzeit-Sekte Aum Shinrikyo (zu deutsch "Höchste Wahrheit") hatte zugeschlagen. Die Bilder von Menschen mit blutigem Schaum vor dem Mund vor dem U-Bahn-Eingang im Regierungsviertel Kasumigaseki gingen damals um die Welt. Zwölf Menschen starben, Tausende wurden verletzt. Heute, neun Jahre nach dem Anschlag, muss Mariko das Essen noch immer im Mixer zerkleinert werden. Das Loch, das die Ärzte ihr damals zur künstlichen Beatmung in die Kehle gebohrt haben, klafft weiter offen.
Todesurteil als vorläufiger Höhepunkt
Das Todesurteil gegen halb blinden Sektengründer ist der vorläufige Höhepunkt in Japans Jahrhundertprozess. Japans Medien ließen schon im Vorfeld keinen Zweifel daran, dass den 48-Jährigen das Todesurteil erwartet. Als Sohn eines Tatami-Mattenherstellers in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, zog Asahara, mit bürgerlichem Namen Chizuo Matsumoto, als Quacksalber umher und gründete eine Yogaschule, aus der die Sekte Aum Shinrikyo hervorging. Der Guru mit dem Rübezahlbart nutzte das spirituelle Vakuum, das nach den wirtschaftlichen Boom-Jahren in Japan entstanden war und die junge Generation zu neuen Religionen wie Aum trieb.
Tausende junger Menschen sahen in Asahara eine charismatische Vaterfigur, von der sie sich verstanden fühlten und die ihnen eine Alternative bot, um aus den Zwängen der japanischen Gesellschaft auszubrechen. Seine devoten Jünger durften sein schmutziges Badewasser und Tropfen seines Bluts kaufen und trinken. Für viel Geld verkaufte er auch Elektrodenmützen zur Kommunikation mit seinen Hirnströmen. Gefolgschaft wurde mit Drogen und Folter erzwungen. Er verlangte angeblich Morde als Mutproben und Loyalitätsbeweise. Opfer von Riten wurden in riesigen Mikrowellenherden beseitigt.
Aber Asahara wollte mehr. Er sagte, Aum müsse sich bewaffnen, um die Apokalypse zu überleben. Vom Staat als religiöse Organisation anerkannt, nutzte die Sekte ihre Steuerfreiheit aus, heuerte fähige junge Wissenschaftler der besten Universitäten an und ließ am Fuße des Berges Fuji ein ganzes Arsenal biochemischer Waffen produzieren. Als sie von einer bevorstehenden Polizeirazzia erfuhren, schlug die Sekte zu.
Auf Reisen im Himalaya und beim Studium tibetischer Mystik will er die Erleuchtung erfahren und die Kraft zum Schweben bekommen haben. Für die Experten war er von Anfang an ein Scharlatan. 1990 trat er mit einer "Wahrheitspartei" bei den Parlamentswahlen an - und fiel kläglich durch. Gerade in dieser Niederlage, in seiner ärmlichen Herkunft, der Behinderung und in seinem Drang, nach oben zu kommen, sehen Experten die Ursprünge und den Wendepunkt für den Wandel seiner Sekte zu einer militanten und kriminellen Organisation.
Sekte in "Aleph" umbenannt
Doch während sich Staat und Medien nun auf die Täter konzentrieren, erinnert sich kaum jemand an die Opfer. Nirgends wird dies deutlicher als bei einem Besuch der inzwischen 40 Jahre alten Mariko Yoshikawa. Ihr Name musste hier geändert werden, weil sich die Familie noch immer vor der Sekte fürchtet, die sich zwar in "Aleph" umbenannt hat, aber weiterhin aktiv ist. Seit dem Anschlag liegt Mariko fast völlig gelähmt im Bett. Ihre mentalen Fähigkeiten sind laut ärztlicher Diagnose durch das Sarin auf die eines Kleinkindes reduziert.
Nichts habe der Staat für sie bisher getan, klagt ihr Bruder. Das Gesundheitsministerium habe auf die Bitten der Opferverbände noch nicht einmal geantwortet. Dabei habe die Sekte das System, die Regierung im Visier gehabt. "Sie wollten die Politiker treffen. Meine Schwester hat es an ihrer Stelle getroffen", sagt ihr Bruder. Jetzt solle die Regierung wenigstens helfen, dass sie würdig leben kann. "Stellen Sie sich einmal vor, wenn uns eines Tages etwas passiert", sagt ihr Bruder. Während er zur Arbeit geht, kümmert sich seine Frau um die nach dem Anschlag erblindete Schwester, seit sie nach Jahren kürzlich aus der Klinik kam, und pflegt zudem auch noch seine Eltern.
Nach jahrelanger Sprachtherapie hat Mariko gelernt, unter großer Kraftanstrengung die Vokale vereinzelter Wörter zu artikulieren, begleitet vom Fauchen aus dem Loch in ihrer Kehle. Doch an ihr Leben vor dem Anschlag erinnert Mariko sich nicht mehr.