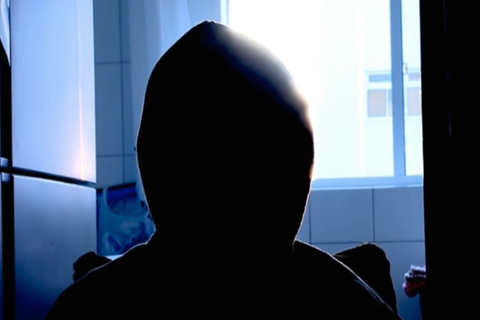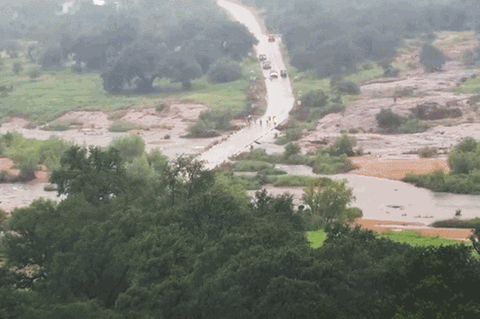In Tübingen haben Mädchen eine 13-Jährige gleich doppelt zum Opfer gemacht: Sie verprügelten sie, filmten ihre Attacke und stellten anschließend das Video ins Netz. Weltweit können Internetnutzer nun mit ein paar Klicks die Misshandlung sehen. Das Internet ist in diesem Fall zum Pranger geworden. "Es ist ein beständiges Problem, das sich in den letzten Jahren auf jeden Fall nicht entschärft hat", sagt der Medienexperte des Landeskriminalamtes (LKA) in Stuttgart, Stefan Middendorf, mit Blick auf das Prügelvideo.
Eine Mädchenclique im Alter von 13 und 14 Jahren soll in der Universitätsstadt die Schülerin verprügelt und getreten haben. Ein Video der Gewaltattacke tauchte auf Youtube und Facebook auf. Die Motive für die Veröffentlichung erläutert der Kinder- und Jugendpsychotherapeut Martin Klett: "Die Täter wollen ihre Macht über das Opfer demonstrieren - möglicherweise, weil sie selbst zuvor Erfahrungen mit Ohnmacht gemacht haben."
Anders als das Cybermobbing handelt es sich bei dem Gewaltausbruch der Mädchen aber eher um eine Ausnahme. "Das ist ein Ausreißer", meint der Münsteraner Kriminologe Klaus Boers. Insgesamt nimmt die Kriminalität von Mädchen ab. Im Südwesten hat sich bei der schweren Körperverletzung der Anteil der weiblichen Tatverdächtigen unter 21 Jahren von 13,2 (2012) auf 12,6 Prozent im vergangenen Jahr vermindert. Eine erfreuliche Entwicklung, meint Middendorf, doch: "Dem Opfer hilft die Statistik allerdings nicht."
Allgegenwärtiges Phänomen
Die technischen Möglichkeiten erleichterten die digitale Schmähung, sagt Middendorf: "Dazu braucht man kein Computercrack zu sein. Heute ist jeder in der Lage, Täter zu sein, aber auch Opfer zu werden."
Statistiken gibt es zu dem "allgegenwärtigen Phänomen" nicht, erklärt der LKA-Experte. Grund: Cybermobbing ist kein eigener Straftatbestand. Überdies sei das Dunkelfeld sehr groß: Denn Angst und Schuldgefühle verhinderten, dass die Opfer sich offenbaren.
Das Dunkelfeld spielt auch bei der Bewertung von Mädchengewalt eine Rolle, sagt Experte Boers. Denn kriminelle Mädchen würden weniger häufig angezeigt als Jungen. Das Alter der mutmaßlichen Schlägerinnen aus Tübingen sei allerdings symptomatisch: Jungen wie Mädchen begehen im 14. Lebensjahr die meisten Gewaltdelikte. "Danach wird es jedes Jahr deutlich weniger", sagt Boers. Mädchen hörten früher auf, schon ab dem 15. Lebensjahr. Auch Intensivtäterinnen sind deutlich seltener als bei Jungen. Unter Mädchen liegt deren Anteil zwischen 0,1 und 0,9 Prozent, bei Jungen zwischen 0,5 und 3,4 Prozent. Typisch ist die Tübinger Attacke, weil sie in einer Gruppensituation geschah. Dies war 2013 bei 53,7 Prozent der Gewaltdelikte der unter 21-Jährigen im Südwesten der Fall.
Seelischer und körperlicher Schaden
Für das verprügelte Mädchen in Tübingen beginnt eine schwere Zeit. Der leicht verletzte Teenager muss nicht nur mit den Blessuren zurecht kommen; das Mädchen wird auch damit leben lernen, dass sein Leid noch sehr lange im Internet kursiert.
Zu hoffen ist, dass Eltern, Freunde und Lehrer sowie möglicherweise Psychotherapeuten der Schülerin helfen, den Angriff zu verarbeiten. Ansonsten könne es zu sozialem Rückzug bis hin zu Schulverweigerung kommen, meint der Freiburger Experte Klett.