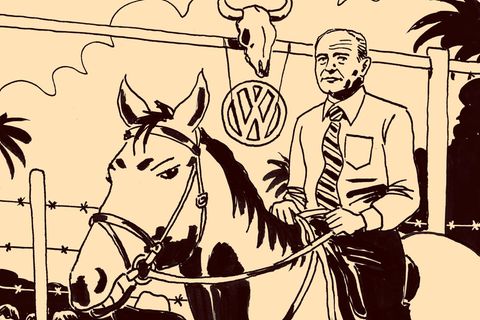1. Von welchen Rindern und Schweinen stammt unser Fleisch?
Weil die meisten Verbraucher billiges Fleisch verlangen, stammen mittlerweile
98 Prozent des ehemaligen Luxusgutes aus Massentierhaltung
. Dafür wurden Rinder- und Schweinerassen bei der Züchtung darauf getrimmt, möglichst viel fettarmes Muskelfleisch in möglichst kurzer Zeit anzusetzen. Andere Rassen, bei denen andere Eigenschaften - etwa Robustheit - im Vordergrund stehen, werden hingegen kaum noch gezüchtet, viele sind nahezu ausgestorben. Das Rindfleisch, das auf deutschen Tellern landet, stammt
zum größten Teil von Jungbullen, die ihr zwischen 12 und 18 Monate langes Leben im Stall verbracht haben
. Ochsenfleisch stammt von kastrierten männlichen Tieren, die nach etwa 30 Monaten Weidehaltung geschlachtet werden. Das Fleisch von Färsen - weiblichen Rindern, die noch nicht gekalbt haben - findet man auf dem deutschen Markt kaum. Es landet bei uns meist nur in der Wurst.
Schweinefleisch stammt ebenfalls fast ausschließlich aus Massentierhaltung.
Die Tiere werden nach etwa sieben Monaten Intensivmast geschlachtet. Da die Verbraucher den Ebergeschmack ablehnen, werden männliche Ferkel ohne Betäubung kurz nach der Geburt kastriert.
2. Was passiert, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abläuft?
Das Fleisch behält bis zu diesem Datum seine spezifischen Eigenschaften, wenn es angemessen aufbewahrt wird. Nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums ist die ware nicht automatisch verdorben. Das Fleisch darf noch verkauft werden - falls es einwandfrei ist. Bei sehr leicht verderblichen Lebensmitteln, die nach kurzer Zeit zu Gesundheitsgefahren führen könnten, muss ein Datum angegeben werden, bis zu dem sie verbraucht sein sollen. Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdatum werden von den Herstellern festgelegt. Gesundheitsschädliche oder nicht sichere Lebensmittel in Umlauf zu bringen, ist verboten.
3. Wie können die Verbraucher verdorbenes Fleisch erkennen?
Wenn das Fleisch süßlich oder unangenehm riecht, ist Vorsicht geboten. Die Ware sollte neutral, mild bis leicht säuerlich riechen. Frisches Fleisch können Verbraucher auch daran erkennen, dass es in der Packung fast trocken ist. Blass, weich und nässend sollte es nicht sein. Viel Wasser in der Verpackung könnte auf früheres Auftauen hindeuten. Frisches Rindfleisch ist dunkelrot gefärbt, Schweinefleisch rosa und hell glänzend, Wildfleisch rötlich bis dunkelbraun. Geflügelfleisch sollte nicht schmierig aussehen und keine Druckstellen haben. Achtung bei gräulicher Farbe!
4. Was ist bei Umgang mit Fleisch zu beachten?
Bevor man es in den Kühlschrank legt, sollte man es auspacken, auf einen Teller legen und mit Frischhaltefolie abdecken. Bei Temperaturen zwischen null und vier Grad hält sich Rindfleisch drei bis vier, Kalb- und Schweinefleisch zwei bis drei Tage. Zerkleinertes Frischfleisch wie Geschnetzeltes oder Gulasch verdirbt schneller. Vor allem Hackfleisch sollte unbedingt noch am selben Tag zubereitet werden. Fleisch sollte nur auf Plastikbrettern liegen und geschnitten werden - auf Holz können sich Keime schneller vermehren.
5. Wie lange darf Fleisch tiefgefroren werden?
Rind-, Schaf- und Schweinefleisch, das entbeint ist, darf nur für eine bestimmte Zeit tiefgefroren gelagert werden. In der Fleischhygieneverordnung sind hierfür bestimmte Fristen festgelegt. Rindfleisch darf nur bis zu eineinhalb Jahren entbeint tiefgefroren gelagert werden, Schaffleisch maximal ein Jahr und Schweinefleisch nur ein halbes Jahr.
6. Wie werden die Tiere gehalten?
In der so genannten Intensivmast dürfen Kälber ihre ersten zwei Lebenswochen in mit Stroh ausgestreuten Ställen verbringen. Da sie sehr anfällig für Krankheiten sind, hält man sie meist isoliert, manchmal auch in kleinen Plastikhütten im Freien. Weibliche Tiere werden später größtenteils Milchkühe, männliche kommen zum Bullenmäster. Dort stehen sie das ganze Jahr über im Stall auf so genannten Vollspaltenböden aus Beton, durch dessen Spalten Kot und Urin in darunter liegende Güllekeller laufen. Jedem Tier stehen maximal drei Quadratmeter zur Verfügung. Jungbullen werden nach etwa 18 Monaten geschlachtet. Dann haben sie ein Gewicht von etwa 650 Kilogramm.
Bio-Rinder
stehen, wenn es die Witterung zulässt, auf der Weide, im Winter in mit Stroh ausgestreuten Ställen, die ihnen ausreichend Platz bieten, um sich natürlich bewegen und hinlegen zu können. Je nach Gewicht sind bei Öko-Haltung mindestens fünf Quadratmeter pro ausgewachsenem Tier und ein sauberer, trockener Ruhebereich vorgeschrieben. Vollspaltenböden sind verboten.
Eine konventionell gehaltene Sau wirft und säugt ihre Ferkel in der
"Abferkelbucht"
. Ihren Trieb, ein Nest zu bauen, kann sie dort nicht ausleben, denn man fixiert sie in einem "Ferkelschutzkorb", in dem sie sich höchstens hinlegen und wieder aufstehen kann. Nach etwa 28 Tagen werden die Ferkel von der Mutter getrennt. Die sieben Monate bis zur Schlachtung verbringen sie dann
auf Vollspaltenböden aus Beton, ohne Stroh zum Wühlen und Liegen
. Je nach Gewicht sind pro Tier zwischen 0,2 und 0,65 Quadratmeter Stallfläche vorgeschrieben. Wenn sie schlachtreif sind, haben die Jungschweine trotz ihrer Milchzähne und des noch nicht voll entwickelten Skeletts mit 100 Kilo das Gewicht erwachsener Exemplare.
In der Bio-Haltung kommen Ferkel auf Stroh zur Welt und trinken mindestens 40 Tage lang Milch. Der Sau und ihrem Nachwuchs stehen als Minimum 7,5 Quadratmeter zur Verfügung. Die Schweine leben in Ställen, in denen Kot- und eingestreuter Ruhebereich voneinander getrennt sind, und können außerhalb des Stalls im Matsch wühlen. Jungschweine haben mindestens 0,8, ausgewachsene Tiere 1,3 Quadratmeter Platz. Mindestens die Hälfte der Stallfläche muss einen geschlossenen Boden haben.
Eine weitere Haltungsform ist die so genannte
extensive Wirtschaftsweise
. Wie im Ökolandbau stehen hier die natürlichen Bedürfnisse der Tiere im Vordergrund. In den Ställen haben sie mehr Platz, als ihnen in der Intensivmast zusteht. Die Böden sind geschlossen und teilweise mit Stroh eingestreut. Spalten befinden sich allenfalls im Fress- oder Kotbereich. Je nach Witterung kommen Rinder auf die Weide, Schweine haben Auslauf zum Wühlen. Alle extensiv wirtschaftenden Verbände haben darüber hinaus eigene Auflagen für ihre Mitglieder (siehe auch Frage 10: Gütesiegel). Beispiele für extensive Erzeugung sind die Marken Neuland und Thönes-Natur.
7. Was fressen die Tiere?
Schweine und Rinder werden so gefüttert, dass sie in kurzer Zeit möglichst viel Muskelfleisch und wenig Fett zulegen. Auch gentechnisch veränderte Pflanzen dürfen in der intensiven Mast ins Futter.
In der Rinderzucht gilt: Kälber trinken in der ersten Lebenswoche so genannte Biestmilch bei ihrer Mutter. Danach bekommen sie Milchaustauscher, eine Mischung aus Magermilch und Pflanzenfett.
Schon ab der zweiten Woche gewöhnt man sie langsam an Gras und Mais- oder reine Grassilage.
Denn je schneller sie sich auf dieses Raufutter einstellen, desto früher entwickelt sich der Pansen (Vormagen), und sie können bei der Mast schneller große Futtermengen aufnehmen. Jungbullen fressen am Tag bis zu 20 Kilo - in der Regel Maissilage, die mit eiweißreichem Schrot (meist Soja, Raps oder Erbsen) angereichert wird. Mit diesem Kraftfutter legen sie täglich bis zu anderthalb Kilo an Gewicht zu.
Beim
Bio-Futter
stehen nicht die Leistung, sondern die Bedürfnisse der Tiere im Vordergrund. Dadurch wachsen sie langsamer und werden erst nach maximal 24 Monaten geschlachtet. Kälber bekommen mindestens die ersten drei Monate Milch, vorzugsweise Muttermilch. Später fressen sie größtenteils frisches Gras, Heu oder Silage und Kraftfuttermischungen aus Getreide, Hülsenfrüchten und Ölsaaten. Alle Futtermittel müssen aus ökologischem Anbau stammen. Gentechnisch veränderte Pflanzen sind tabu. Auch bei extensiver Haltung kommen in der Regel weder Leistungsförderer noch gentechnisch veränderte Pflanzen ins Futter.
In der Schweinezucht gilt: Es gibt eine
Vielzahl verschiedener Futtermischungen
. Sehr gebräuchlich sind geschrotete und silierte ganze Maiskolben, der so genannte Corn-Cob-Mix. Dazu kommt proteinreiches Schrot aus Soja, Raps oder Erbsen. Auch biotechnisch hergestellte Aminosäuren sind in der Schweinemast zur Proteinversorgung üblich.
Auf Bio-Höfen bekommen Schweine ausschließlich Futter aus ökologischer Landwirtschaft, das nicht von gentechnisch veränderten Pflanzen stammen darf. Auch der Eiweißbedarf der Tiere wird ausschließlich mit pflanzlicher Nahrung gedeckt, synthetische Aminosäuren dürfen nicht verwendet werden.
8. Was darf sonst noch ins Futter?
Erlaubt sind bei der intensiven Tierhaltung so genannte Leistungsförderer, die die Verwertung der Nahrung verbessern und so schnellere Masterfolge bringen. Dazu gehören Probiotika und organische Säuren, wie etwa Milchsäure. Außerdem erhalten die Tiere Mineralfuttermischungen mit Enzymen, Spurenelemente und Vitamine.
Der
Einsatz von Hormonen
als Leistungsförderer ist EU-weit verboten. Seit 1994 darf außerdem kein Tiermehl mehr verfüttert werden. In Deutschland sind seit der BSE-Krise 2001 auch Tierfette nicht mehr zugelassen. Eine Ausnahme bildet Fischmehl, das an Schweine verfüttert werden darf, sofern auf dem Hof kein einziger Wiederkäuer lebt.
Bis vor kurzem waren
Antibiotika
als Leistungsförderer erlaubt und wurden dem Futter routinemäßig beigemischt. Seit Beginn dieses Jahres dürfen sie nur noch vom Tierarzt gezielt als Medikament verabreicht werden. Weil die Tiere durch die schnelle Aufzucht und die Massenhaltung anfällig sind für Krankheiten, wird jedoch oft auch vorbeugend gespritzt.
Lebensmittelkontrolleure stoßen immer wieder auf Medikamentenrückstände im Fleisch, die beim Menschen zu Resistenzen führen können. Einige Antibiotika gelten daher bereits als wirkungslos für die medizinische Therapie.
In der Bio-Mast verzichtet man auf Leistungsförderer. Auch
Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente
kommen nur in der Dosis ins Futter, die den Bedarf der Tiere deckt.
9. Wie werden die Tiere transportiert?
Um Fleisch möglichst billig produzieren zu können, teilen sich jeweils mehrere spezialisierte Betriebe die Arbeit: Kälber- beziehungsweise Ferkelerzeugung, Aufzucht, Mast, Schlachtung, Zerlegen. Für die Tiere bedeutet das immer wieder aufs Neue Angst und Stress durch Transporte in engen, oft mehrstöckigen Lkws.
Zunehmend werden dabei
sehr lange Strecken
zurückgelegt. Zum Beispiel weil immer mehr regionale Schlachthöfe der Konkurrenz durch riesige Schlachtfabriken nicht mehr gewachsen sind. Und weil in Spanien bestimmte Auflagen bei der Verarbeitung laxer gehandhabt werden oder in polnischen Mastbetrieben die Löhne niedriger sind - in der industriellen Fleischproduktion lohnen sich schon Preisunterschiede von ein paar Cent.
Für Transporte innerhalb der EU gibt es gesetzliche Bestimmungen zum Tierschutz. So sind zum Beispiel spätestens nach acht Stunden
Ruhepausen
vorgeschrieben, in denen die Tiere gefüttert und getränkt werden müssen. Tierschützer kritisieren die bestehenden Regeln als unzureichend und weisen darauf hin, dass selbst diese Mindeststandards oft nicht eingehalten werden.
Darunter leiden nicht nur die Tiere, sondern auch die Fleischqualitäten: Bei Schweinen etwa sinkt der pH-Wert ihres Fleisches in kurzer Zeit stark ab, wenn sie beim Schlachten zu großem Stress, Angst und Erschöpfung ausgesetzt sind. Das Ergebnis ist so genanntes pse-Fleisch - blass (pale), weich (soft), wässrig (exudative).
Es schmeckt zäh und trocken, verdirbt schnell und schrumpft beim Zubereiten. In der extensiven Haltung müssen Transport und Schlachtung schonend verlaufen. Bio-Schweine und -Rinder wachsen in der Regel auf ein und demselben Hof auf. Transporte dürfen nicht länger als vier Stunden dauern.
10. Wie werden die Tiere geschlachtet?
Zunächst werden sie betäubt: Rindern treibt man dafür einen Metallbolzen etwa acht Zentimeter tief ins Hirn. Schweinen verabreicht man entweder Kohlendioxidgas oder setzt ihnen eine Stromzange an die Schläfen. Getötet werden beide anschließend durch einen Halsschnitt. Dabei muss das Herz noch möglichst lange schlagen, denn je besser das Fleisch ausblutet, desto haltbarer ist es.
Ein Tierarzt untersucht das Blut und den so genannten Schlachtkörper auf krankhafte Veränderungen und Qualitätsmängel und gibt ihn, wenn alles in Ordnung ist, als "tauglich für den menschlichen Verzehr" frei. Danach muss das Fleisch auf eine Temperatur von sieben Grad runtergekühlt werden. Geschieht das zu schnell oder zu langsam, wird es zäh.
Rindfleisch muss anschließend mindestens 14 Tage reifen, Schweinefleisch braucht nur zwei bis drei Tage. Bei diesem so genannten Abhängen entwickelt sich das Aroma. In der Regel ist das Fleisch dabei schon zerteilt und in Folien verpackt.
Fleischreste, die an Schweineknochen hängen bleiben, werden maschinell gelöst, zerkleinert und durch ein Sieb gedrückt.
Separatorenfleisch
heißt dieser Brei aus Bindegewebe, Knorpeln und Sehnenenden. Er darf weiterverarbeitet werden, vorausgesetzt, er stammt nicht von Rindern, Schafen oder Ziegen. Auf dem fertigen Produkt muss außerdem auf diesen Inhalt hingewiesen werden. Da das nicht eben verkaufsförderlich ist, wird diese Vorschrift oft missachtet.
Bei Rindern sind die Auflagen wegen der BSE-Gefahr strenger - die meisten Schlachtabfälle müssen verbrannt werden. Nur ein kleiner Teil wird zu Tiermehl verarbeitet, das jedoch nur für die Herstellung von Heim- und Zootierfutter zugelassen ist.
11. Wie wird das Fleisch gekennzeichnet?
Seit der BSE-Krise bekommt jedes Rind, das in der EU geboren ist oder in die EU importiert wird, Ohrmarken mit einer zwölfstelligen Registriernummer und einen Pass, der es sein Leben lang begleitet. Darin werden sämtliche Daten dokumentiert - vom Muttertier über Geburtsdatum, Rasse und Geschlecht bis zum Datum der Schlachtung. Bauern müssen die Daten über ihren Viehbestand ständig aktualisieren und jede Änderung behördlich melden. Sämtliche Informationen laufen in einer zentralen Datenbank zusammen, sodass sich im Zweifelsfall der Weg jedes Rindes zurückverfolgen lässt.
Im Schlachthof werden die Ohrmarken entfernt, und die Nummer wird mit einer fortlaufenden
Schlachtnummer
verknüpft. Erst im Zerlegebetrieb verliert sich die Spur des Einzeltiers. Denn hier wird der Schlachtkörper zerteilt und nach Teilstücken sortiert. Mit den so genannten Chargen, zu denen das Fleisch jetzt zusammengefasst wird, lässt sich ab diesem Punkt der Verarbeitung nur noch nachvollziehen, aus welcher Tierlieferung eines Landwirts das jeweilige Stück stammt, nicht jedoch von welchem Rind.
Schweine werden nicht einzeln registriert. Bei ihnen wird der so genannte Bestand eines Landwirtschaftsbetriebs mit einer Nummer auf Ohrmarken festgehalten. Auch für sie gibt es eine zentrale Datenbank, an die der Landwirt regelmäßig die Zu- und Abgänge seines Betriebes melden muss. Im Schlachthof werden die Tiere dann mit einer weiteren Nummer erfasst, die ihnen noch bei lebendigem Leib auf den Rücken tätowiert und mit der Registriernummer der Ohrmarke verknüpft wird.
12. Wie wird kontrolliert?
Theoretisch unterliegt die Fleischproduktion ununterbrochener Kontrolle: vom Ferkel bis zur Wurst, vom Kalb bis zum Burger. Tierärzte sollten das Vieh bei der Ankunft im Schlachthof in Augenschein nehmen und das Töten überwachen. Nicht selten bleibt es jedoch nur bei dem Begutachten der Schlachtkörper.
Dass dabei alles mit rechten Dingen zugeht, sollen bundesweit
2500 staatliche Prüfer
bei regelmäßigen unangekündigten Besuchen sicherstellen. Doch Lebensmittelkontrolle ist Ländersache und wird nicht überall mit gleicher Intensität verfolgt. Auch die personelle Besetzung schwankt. Dadurch laufen viele Maßnahmen, die auf Bundesebene beschlossen werden, in der Praxis vor Ort immer wieder ins Leere.
Für wirtschaftlich unabhängige Kontrollen hingegen ist die Zahl der staatlichen Prüfer aus Sicht von Verbraucherschützern zu gering: Im Schnitt kann gerade mal die Hälfte aller Betriebe überprüft werden - einmal im Jahr. Ob der jüngste Fleischskandal bei der neuen Regierung ein Umdenken fördert, ist fraglich: Die CDU/CSU, die den Landwirtschafts- und Verbraucherschutzminister stellt, hatte in ihrem Agrarprogramm zur Bundestagswahl angekündigt, staatliche Kontrollen auf ein Mindestmaß zurückzufahren.
Die vielen Arbeitsschritte, die spezialisierte Betriebe unter sich aufteilen, sowie grenzüberschreitende Geschäfte machen die Fleischproduktion zusätzlich unübersichtlich. Viele Betriebe verpflichten sich inzwischen zu
freiwilligen Selbstkontrollen
.
13. Was steht auf dem Etikett?
Sowohl bei Rind- als auch bei Schweinefleisch muss neben der Tierart der Name des Lebensmittels angegeben sein, zum Beispiel Filet. Dazu das Gewicht und das Mindesthaltbarkeitsdatum. Bei Hackfleisch dürfen außerdem Hinweise zur richtigen Lagerung nicht fehlen. Da es leicht verderblich ist, findet man auf dem Etikett statt des Mindesthaltbarkeitsdatums das Verbrauchsdatum mit der Formulierung "zu verbrauchen bis ...". Nach Ablauf dieses Datums darf das Fleisch nicht mehr verkauft werden.
Bei Rindfleisch muss außerdem genau angegeben sein, wo das Tier geboren, gemästet, geschlachtet und zerlegt wurde ("ES" steht dabei für "Europa-Schlachthof", "EZ" für "Europa-Zerlegungsbetrieb"). Handelt es sich bei beiden um dasselbe Land, reicht die Angabe "Herkunft". Mit einer Referenznummer, die ebenfalls Pflicht ist, lässt sich zurückverfolgen, aus welchem Tierbestand das Fleisch ursprünglich kommt.
14. Was besagen die Gütesiegel?
Leider oft nicht allzu viel, denn theoretisch kann sich jeder Hersteller sein eigenes Siegel verleihen. Begriffe wie "geprüfte Qualität" oder "aus tiergerechter Haltung" sind nicht geschützt, und so gibt es eine verwirrende Vielfalt verschiedener Regional-, Prüf-, Qualitäts- und Umweltzeichen. Wofür sie im Einzelnen stehen, ist für den Verbraucher meist nicht ersichtlich - und oft ohnehin nicht hilfreich.
So verbirgt sich hinter dem blauen Emblem
"QS - Qualität und Sicherheit"
, das seit 2001 auf vielen Produkten prangt, eine Selbstverpflichtung etlicher Unternehmen der Fleischindustrie, vom Futtermittelhersteller bis zum Einzelhändler, sich an bestimmte Standards zu halten und entsprechende Kontrollen durchzuführen. Tatsächlich sichern sie damit jedoch kaum mehr zu, als es die Gesetze ohnehin vorschreiben. Lediglich die Dokumentationspflicht geht über das geforderte Maß hinaus.
Verbraucherschützer fordern deshalb schon lange eine staatlich kontrollierte Kennzeichnung, die Fleischkunden wirkliche Orientierung verschafft, indem sie Auskunft über die Bedingungen gibt, unter denen das Fleisch produziert wurde. Bislang ist das sechseckige
EU-Bio-Siegel
das einzige staatliche Zeichen. Es garantiert, unabhängig von Betriebsart und Herkunft, dass bei der Produktion die Regeln der EU-Öko-Verordnung eingehalten wurden.
Einen guten Überblick über die gängigsten Siegel für intensive, extensive und ökologische Tierhaltung bietet der Einkaufsführer
"Fleisch. Iss gut!"
der Verbraucherzentrale Hessen. Interessant ist dabei auch die Liste der Hersteller, die den Verbraucherschützern die Auskunft verweigerten, darunter "Bauernglück" (vertrieben von Aldi Nord), "Erlenhof" (Rewe) und "Birkenhof" (Tengelmann). Die Broschüre bekommen Sie für zwei Euro in jeder Verbraucherzentrale.
15. Wie kommt der Fleischpreis zustande?
Auch beim Fleisch regiert das Gesetz von Angebot und Nachfrage. So ist Schweinenacken zur Grillzeit im Sommer teurer als jetzt, und wenn die Verbraucher aus Angst vor BSE lieber Putenschnitzel kaufen, sinkt der Preis für Rindfleisch.
Die Verbraucher bestimmen den Fleischpreis maßgeblich mit.
Und sie verlangen - vor allem in Deutschland - von Fleisch in erster Linie, dass es billig ist. Dadurch stehen alle Beteiligten - vom Landwirt bis zum Wursthersteller - unter dem gnadenlosen Preisdiktat des Marktes.
Für ein schlachtreifes Mastschwein bekommt ein Bauer zurzeit etwa 136 Euro (1,45 Euro pro Kilo Fleisch), für einen Jungbullen 1060 Euro (2,80 Euro pro Kilo Fleisch). Im Supermarkt kostet Schweinefleisch dann mitunter weniger als Katzenfutter. Ohne Massentierhaltung ist eine Erzeugung zu solchen Preisen unmöglich - und selbst mit ist sie kaum zu schaffen.
Tiere artgerecht aufzuziehen erfordert mehr Zeit, Platz und Personal und macht mehr Arbeit. Fleisch aus artgerechter oder ökologischer Haltung ist darum erheblich teurer als das aus konventioneller Intensivmast. Doch das ist auch aus anderen Gründen scheinbar zum Schnäppchenpreis zu haben: Die Kosten für Umweltschäden, die durch diese Haltungsform entstehen, wie zum Beispiel verschmutzte Gewässer oder überdüngte Böden, zahlt letztlich die Allgemeinheit. Im Ladenpreis sind sie nicht enthalten. Was man aber beim Einkauf spart, legt man schließlich als Steuerzahler wieder drauf.