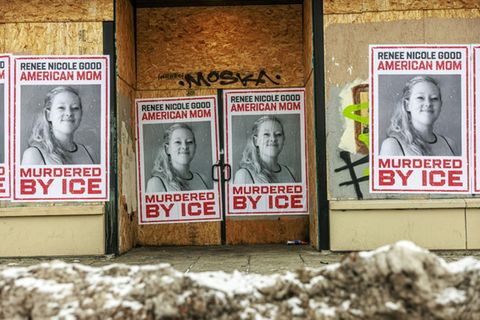Folter hat es immer gegeben und viele Regierungen haben sie stets geächtet. Doch nach den Anschlägen am 11. September 2001 haben die USA Rechtsexperten zufolge für sich neu definiert, was unter Folter zu verstehen ist und wann ein mit erheblichen Druckmitteln geführtes Verhör zur Folter wird. Die gegen die Vereinigten Staaten erhobenen Vorwürfe, sie unterhielten Geheimgefängnisse und würden Gefangene in Ländern wie Afghanistan misshandeln, machten deutlich: Die Regierung von Präsident George W. Bush nimmt für sich eine großzügige Auslegung des Folterverbots in Anspruch und hat sich damit in einen neuen Konflikt mit traditionellen Verbündeten manövriert.
In den USA werde das Thema seit den Anschlägen in einem neuen Licht betrachtet, sagt der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen (UN) für Folter, der Österreicher Manfred Nowak. Das Argument laute: "Wir leben unter neuen Bedingungen. Der 11. September hat die Spielregeln verändert und deswegen müssen wir das absolute Verbot von Folter überdenken." In der Folge hat die Regierung von US-Präsident George W. Bush wiederholt Ausnahmen von den internationalen Verträgen gegen Folter geltend gemacht, die auch die USA unterzeichnet haben.
Folterverbot nur auf US-amerikanischem Gebiet
So fielen Ausländer, die im Rahmen des von den USA geführten "Krieges gegen den Terrorismus" gefangen genommen worden seien, nicht unter die Genfer Konventionen für den Umgang mit Kriegsgefangenen. Und die 1984 geschlossene UN-Konvention gegen Folter gelte nur für den Umgang mit Gefangenen auf US-Territorium. So betrachtet wären die USA weder gegenüber den in Guantanamo festgehaltenen Terror-Verdächtigen an das Folter-Verbot gebunden noch in Geheimgefängnissen, die sie unter anderem in Ost-Europa unterhalten sollen.
Die Bush-Regierung versuchte damit nicht zuletzt Mitarbeiter ihres Geheimdienstes CIA zu schützen, die Medienberichten zufolge in Verhören "erweiterte Befragungstechniken" anwenden dürfen. Techniken, bei denen auch republikanische Senatoren wie der Vietnam-Veteran John McCain keinen Unterschied zu Folter erkennen können. Die Gefangenen dürfen demnach extremer Kälte ausgesetzt oder geschlagen werden. Sie dürfen aber auch Prozeduren unterzogen werden, die sie in Todesangst versetzen. Konkret ist es den Medienberichten zufolge erlaubt, Gefangene auf ein Brett zu schnallen, ihr Gesicht unter einer Cellophane-Folie einzuschließen, das Brett in Schräglage zu kippen, so dass sie kopfunter liegen, und sie dann mit Wasser zu übergießen. Das Opfer hat das Gefühl zu ertrinken. "Ich bin überzeugt, das ist Folter", sagte McCain. "Eine sehr raffinierte Version von Folter."
"Misshandelte Gefangene liefern meist schlechte Informationen"
US-Außenministerin Condoleezza Rice hat die europäischen Verbündeten in diesen Tagen darauf aufmerksam gemacht, dass auch das Leben von Bürgern ihrer Länder durch Informationen gerettet werde, die die US-Geheimdienste sammelten. Umfragen zufolge sind 46 Prozent der Amerikaner davon überzeugt, dass es manchmal oder oft gerechtfertigt sei, Terrorverdächtige zu foltern, um wichtige Informationen zu erhalten. 17 Prozent sagten, ein solches Vorgehen sei gelegentlich gerechtfertigt. McCain sagt dagegen, gefolterte Gefangene erzählten alles, was ihre Folterer hören wollten, um der Qual ein Ende zu machen. "Misshandelte Gefangene liefern meist schlechte Informationen."
McCain brachte den US-Kongress dazu, die Regierung Bush zu einer Rückkehr zum international geltenden Verständnis des Folter-Verbots aufzufordern. Sie sträubte sich wochenlang, aber mitten auf der Europa-Reise der Außenministerin lenkte sie nun plötzlich ein. Das Folterverbot müsse von US-Bediensteten auch außerhalb der USA strikt eingehalten werden, sagte Rice am Mittwoch in der Ukraine. Also auch von US-Verhörspezialisten in Afghanistan, Irak oder wo auch sonst sie im gerade im Einsatz sind.