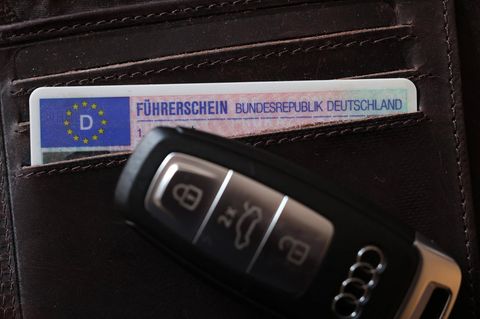Es wurde noch heftig gestritten innerhalb der EU-Kommission, doch genützt hat es nichts - jedenfalls nicht den deutschen Interessen: Automobilkonzerne sollen per Dekret künftig einen stärkeren Beitrag zum Umweltschutz leisten, und dieser Beitrag - das wurde überdeutlich, als der griechische Umweltkommissar Stavros Dimas einen Vorschlag für ein CO2-Reglement für PKW in Europa vorstellte - wird vor allem den hiesigen Konzernen abverlangt. Für die deutsche Industrie sowie die Bundespolitik, die im Vorfeld in Brüssel versucht hatte, der vorgesehenen Abgasregulierung die Schärfe zu nehmen, ist das schlicht ein Desaster. Autohersteller sollen ab 2012 Strafen zahlen müssen, wenn ihre Fahrzeuge bestimmte CO2-Limits überschreiten. Die Höhe der zulässigen Abgaswerte ist vom Gewicht der Wagen abhängig. Freiwillige Verpflichtungen der Industrie, den Ausstoß von Treibhausgasen zu senken, hatten nichts gebracht. Der Verkehr verschmutzt die Luft immer mehr. So weit, so klar. So konnte es nicht weitergehen. Und Strafe muss sein.
Deutschland gegen Frankreich
Das Problem des neuen Gesetzesvorschlags ist die Verteilung der Lasten. Er bevorzugt deutlich die Hersteller von Kleinwagen: Sie müssen kaum noch CO2 einsparen, um die Grenzwerte zu erreichen; Autobauer von Limousinen und Sportwagen sind hingegen umso mehr gefordert. Bei Peugeot, Renault und Fiat dürfte daher nun Jubel ausbrechen. Bei BMW und Daimler herrscht hingegen Katerstimmung. Sie liegen noch so weit von den EU-Zielen entfernt, dass die Bußgelder schnell in die Milliarden gehen könnten, wenn sich der Benzinverbrauch bei großen Autos nicht drastisch senken lässt. Deutschland gegen Frankreich - so war Poker um die neuen Abgaswerte in Brüssel zuletzt wahrgenommen worden; Merkel gegen Sarkozy. Nicht nur der große Verlierer des EU-Vorstoßes steht nun also fest, sondern auch der Gewinner. Zwar muss das Gesetz noch durch das Parlament, und schließlich haben die Mitgliedsländer das letzte und entscheidende Wort. Dass es aber gänzlich umgekrempelt werden kann, ist kaum wahrscheinlich.
Verheugen ist gescheitert
Bizarr wirkt dabei der Vorschlag von Umweltkommissar Dimas, die Autokonzerne dürften beim Errechnen des Abgassünder-Zolls einen Pool bilden, um Strafzahlungen an die EU zu vermeiden oder zu mindern. Was bedeutet so ein Abgaskartell? Nichts anderes, als dass die Hersteller kleinerer Autos CO2-Kontingente auf dem Markt verkaufen können, wenn sie das EU-Limit unterschreiten. In anderen Branchen mag Emissionshandel machbar sein. So wie er nun angelegt ist, kann er praktisch dazu führen, dass einen Teil des Gewinns der hiesigen Autoindustrie an die Konkurrenz aus Italien und Frankreich überwiesen wird. Eine krude Vorstellung. Eigentlich ist in Brüssel ein Kommissar im Amt, der sich anschickte, potenzielle Wettbewerbsverzerrungen, die durch eine C02-Gesetzgebung entstehen könnten, zu unterbinden: der deutsche SPD-Politiker Günter Verheugen. Er ist einer der Vizepräsidenten der Kommission. Er hatte die Osterweiterung der Gemeinschaft vorangetrieben. Nun ist er für den Sektor Industrie zuständig. Verheugen war gegen den Entwurf seines Kollegen Dimas, aber man hat nicht auf ihn gehört. Nicht mehr. Auch das ist an diesem Tag vielen aufgefallen.