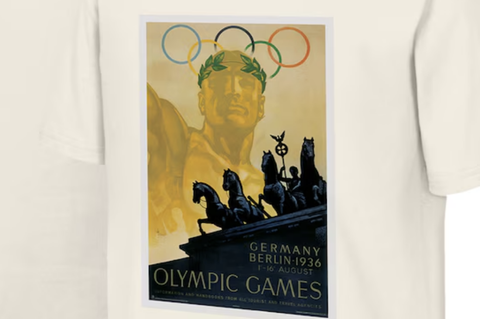Der freundliche ältere Herr kocht Kaffee in seiner Berliner "Arbeitswohnung". Inmitten von Büchern und Papieren schreibt er hier unter einem riesigen Porträt seiner schönen Frau Sonia kluge Bücher. Wettert gegen die USA und den Einsatz der fremden Soldaten in Afghanistan: "Das wird Folgen haben." Die Freiheit, so glaubt er heute, lässt sich nicht herbeibomben. Anders als viele aus der Studentenbewegung hat sich Nirumand nicht angepasst. Natürlich schwärmt er nicht mehr für die chinesische Kulturrevolution und auch nicht für die damals als "neue Menschen" umjubelten Kämpfer vom Schlage eines Che Guevara.
Aber radikal ist er geblieben. Ein Außenseiter mit Charme. Oft fühle er sich fremd, wenn er mit Schriftstellerkollegen oder Redakteuren zu tun habe, sagt er. Dabei schätzt er ein Privileg mehr als alle, die es für selbstverständlich erachten und ihr Leben lang genossen haben: "Ich kann sagen, schreiben und publizieren, was ich will."
Alles fing mit einem Besuch bei Enzensberger an
Angefangen hat seine Karriere als einflussreicher Teil der westdeutschen Linken bei einem Besuch von Hans Magnus Enzensberger im Iran in den frühen sechziger Jahren. Nirumand arbeitete - nach einem Studium in Deutschland - damals am Goethe- Institut in Teheran, wo Enzensberger ihn nach einem Vortrag auf die Seite nahm und das Gespräch suchte. Es dauerte mehrere Tage und am Ende forderte der deutsche Großintellektuelle ihn auf, ein Buch über sein Land zu schreiben. Es erschien 1967: "Persien. Modell eines Entwicklungslandes oder die Diktatur der Freien Welt". Das Buch wurde in jeder Hinsicht ein Erfolg. Und Nirumand, pünktlich zum Beginn der Revolte zurück in Berlin, zum Sprecher der Unterdrückten dieser Welt.
Die 68er im stern
In acht Teilen entwirft der stern das Porträt einer bewegenden Zeit: von Vietnam und Protest, von Autoritäten und Partys, von Rebellion und Befreiung.
Lesen Sie in Teil II: Die Studenten empören sich über den US-Feldzug in Vietnam. Der Krieg in der dritten Welt befeuert die Revolte in der Ersten.
stern.de begleitet die Serie mit zusätzlichen Interviews, Ton- und Bilddokumenten aus der Zeit, Wissenstests und Fotostrecken.
Am Vortag des Schah-Besuchs in Berlin 1967 hielt er eine umjubelte Rede vor tausenden Zuhörern. Die iranische Botschaft hatte versucht, seinen Auftritt zu verhindern. Der Berliner Senat war auch gegen ihn - aber die Uni verteidigte das Recht auf die freie Rede. Und so stand er dann im Audimax der Freien Universität, umspült vom Jubel der Zuhörer - und niemand wollte seine scharfsinnigen Analysen hören. Aber alle genossen das Gefühl, zusammen für eine bessere Welt zu streiten.
Am nächsten Tag fiel dann nach der Demonstration gegen den Schah der tödliche Schuss auf den Studenten Benno Ohnesorg. Sein Tod wurde zum Fanal. Von da an war alles anders. Die Studenten radikalisierten sich, die Springer-Presse hetzte und die Polizeigewalt nahm weiter zu. Täglich hat er in den Monaten danach mit Rudi Dutschke, dem Frontmann des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS), zusammen gesessen. Sie waren sich einig, dass aus dem Protest gegen den Krieg der Amerikaner in Vietnam nun Widerstand werden müsse. "Wir wollten auch praktisch etwas tun", erinnert er sich. Einmal hantierten sie tatsächlich mit einer Bombe. Sie sollte einen Sendemast des amerikanischen Soldatensenders AFN umlegen. "Wir wollten dem US-Imperialismus Schaden zufügen", sagt Nirumand. Einen halben Tag, vielleicht einen ganzen wollten sie den Propagandasender lahm legen. Zum Glück kam es nicht dazu.
Als dann im Herbst der Bewegung ein paar versprengte Revolutionäre in den Untergrund abdrifteten, bat Nirumand sie eindringlich, den Wahnsinn zu lassen. Er strich gerade den Fensterrahmen in seiner Küche, als Ulrike Meinhof bei ihm klingelte. Sie war eine gute Freundin. "Die Frage der revolutionären Gegengewalt muss hier und jetzt gestellt und beantwortet werden", sagte sie, düster entschlossen, ihr bürgerliches Leben zu beenden. Es gelang ihm nicht, sie davon abzubringen. Sie haben sich nie wieder gesehen.
Zehn Jahre später zeichnete sich im Iran das Ende des Schah-Regimes ab. Nirumand, der 1965 geflohen war, kehrte zurück in die alte Heimat. Aber bald nach der Machtübernahme der Mullahs wurde der alte Schrecken durch einen neuen ersetzt und er musste das Land wieder verlassen. Für Nirumand, der über Bert Brecht in Deutschland promoviert hatte, wurde das Exil zur Lebensform.
Rentner, aber kein bisschen müde
In Frankfurt führte er viele Jahre die Geschäfte der Kommunalen Ausländervertretung. Jetzt ist er Rentner, zurück in Berlin. Aber kein bisschen müde. Sein neues Buch über den Nahost-Konflikt - Titel: "Der unerklärte Weltkrieg" - liegt druckfrisch in den Buchhandlungen. Darin streitet er gegen "westliche und verwestlichte Intellektuelle", die der Meinung seien, der Islam sei mit der Demokratie nicht vereinbar. Eine Reform sei möglich, schreibt er, die Ideen dazu würden nur zu wenig beachtet, da eine radikale islamistische Minderheit die Schlagzeilen beherrsche. Das passe jenen ins Konzept, "die durch die Dämonisierung des Islam die gewaltsame Durchsetzung ihrer Interessen legitim erscheinen lassen wollen". Man könnte auch sagen: Es nutzt dem US-Imperialismus - und der hat in Nirumand einen verlässlichen Feind.