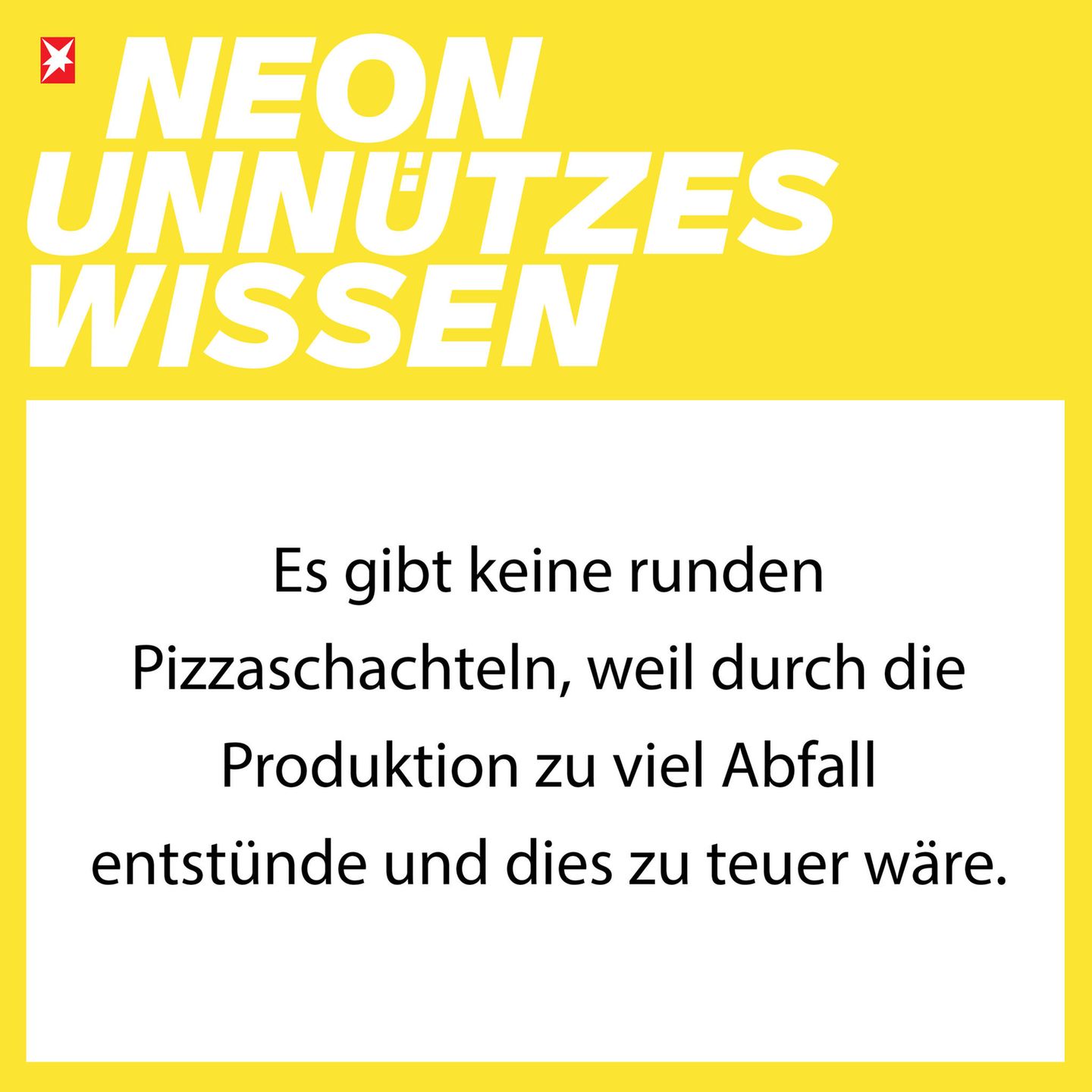Herr Lübben, Sie forschen zum Thema Müll in Hamburg. Schmeißen die Hanseaten auch wertvolle Dinge weg?
Eigentlich nein, aber dennoch kommt da einiges zusammen, wenn Sie damit auch Dinge wie Schrott und Nichteisenmetalle gemeint haben. Wir haben das mal hochgerechnet, wie viel Geld in Hamburg da zusammenkommen würde, das wären über Hunderttausend Euro. Wir haben sogar schon Goldmünzen gefunden. Die landen natürlich aus Versehen im Müll. Bei einer Haushaltsauflösung wird der Kram häufig nur schnell in blaue Säcke gestopft und dann ab in den Müll. Und die Oma hatte aber die Krugerrand-Münzen in der Schublade mit der Unterwäsche versteckt - und wir finden sie letztendlich in der Schlacke wieder.
Schlacke ist das, was übrig bleibt - ist also der Rest vom Rest. Wie viel ist das denn?
Bei der Verbrennung von Restmüll bleiben in etwa 25 Prozent als noch nicht aufbereitete Rohschlacke übrig. Die setzt sich aus unterschiedlichen mineralischen Materialen zusammen und nur rund 10 Prozent dieser Rohschlacke (also rund 2,5 Prozent vom Restmüll) sind Metalle. Davon sind etwa drei Viertel Eisen und der Rest, also weniger als ein Prozent vom Restmüll, sind sogenannte Nicht-Eisen-Metalle, wie Edelstahl, Nickel, Kupfer, Zink und Zinn. Es findet sich Silber und Gold leider nur in kleinsten Mengen in der Schlacke.

Und was macht man dann mit der Schlacke?
Nachdem wir die Metalle weitgehend abgetrennt haben, nutzen wir Schlacke weitestgehend im Unterbau von Straßen und Wegen, aber auch beim Unterbau von Gebäuden.
Wie kann ich mir das vorstellen? Die Schlacke wird einfach auf die Straße gebracht?
Nein, wie und wo Schlacke eingesetzt wird, ist klar von der für den öffentlichen Wegebau zuständigen Behörde geregelt. Wir haben in Hamburg die Regelung, dass Schlacke als Ersatzbaustoff neben anderen Ersatzbaustoffen immer (vorrangig) dann genutzt werden darf, wenn die Einbaufläche mindestens einen Meter über dem Grundwasserstand und nicht in Landschafts-, Natur- oder Wasserschutzgebieten liegt. Schlacke darf, wie alle anderen Ersatzbaustoffe auch, nicht mit dem Grundwasser direkt in Verbindung kommen.

Und wo landet die Schlacke genau?
Wenn jemand einen Unterbau für eine Betonfläche oder für den Straßenbau plant, bei der er schotterartiges Material benötigt, dann kommt Schlacke als recycelter Ersatzbaustoff ins Spiel. Der Bauherr kann entscheiden, welches Material er als Untergrund einsetzt, wobei für öffentliche Bauvorhaben in Hamburg aus Umweltschutzgründen zur Schonung der natürlichen Ressourcen vorgegeben wird, nach Möglichkeit Ersatzbaustoffe zu verwenden.
Welche Stoffe gibt es denn zur Auswahl?
Zum einen die natürlichen, geogenen Materialen, die direkt aus einer Kiesgrube kommen oder aus einem Steinbruch. Zum anderen gibt es die Möglichkeit, Recyclingmaterial zu nehmen. Damit ist in erster Linie Recyclingbeton gemeint, der beim Rückbau von Gebäuden anfällt. Das sind dann zerbrochener Beton oder Ziegel bis hin zu Schutt. Eine weitere Möglichkeit wäre die aufbereitete Müllverbrennungsschlacke.
Wie unterscheiden sich die Materialen preislich?
Die Stoffe haben regional betrachtet in Deutschland sehr unterschiedliche Preise. Naturschotter gibt es in bergigen Gegenden viel günstiger als hier im Flachland. In Norddeutschland sind Naturbaustoffe sehr hochpreisig, da es hier weniger Grobmaterial gibt. Selbst Kies ist in letzter Zeit sehr teuer geworden. Bei einer kleinen Baustelle merkt der Bauherr hier schnell, dass der Unterschied zwischen Primärrohstoff, Recycling-Beton oder Recycling-Schlacke als Ersatzbaustoff groß sein kann. Bei großen Mengen kann das schnell einen sechsstelligen Betrag ausmachen.
Geben Sie mir mal ein Beispiel…
Musterbeispiel ist in Hamburg der Bau des Containerterminals Altenwerder. Da sind hunderttausende Tonnen aufbereiteter Schlacke reingegangen. Da macht das dann richtig was aus. Da ist der Preiskampf entscheidend. Beim Preis orientieren wir uns bei der Schlacke an Konkurrenzprodukten. Und da kommen wir in Hamburg ganz gut zum Zuge. Wenn uns das gelingt, können wir die Schlacke auch als recycelten Baustoff am Markt platzieren. Das ist entscheidend: Die Schlacke wird nicht entsorgt, sondern verwertet. So gelingt es uns, 140.000 bis 180.000 Tonnen jährlich als Ersatzbaustoff zu vermarkten.
Schlacke galt jahrzehntelang als mieser Baustoff, der randvoll mit Giften auf Straßen, Parkplätze und Spielplätze als Untergrund gebracht wurde. Ist Schlacke gefährlich?
Definitiv nicht! Der Hamburger Senat hat vor vielen Jahren schon klargemacht, dass bevorzugt recycelte Baustoffe zu verwenden sind. Aber jeder, der Schlacke einsetzt, weiß, dass Schlacke neben positiven Eigenschaften auch Spuren von Verunreinigungen enthalten kann und daher sehr intensiv aufbereitet und güteüberwacht wird. In Schlacke stecken auch Metalle, deren Salze wasserlöslich sein können. Und wenn dann jahrelang Wasser durchtröpfelt, dann kann es passieren, dass diese Salze ausgewaschen werden und so die Metallverbindungen im Grundwasser landen. Daher gibt es Richtlinien für die umweltverträgliche Anwendung von Schlacken mit Grenzwerten.
Was steckt genau in Schlacke?
Bei den zu überwachenden Stoffen sind es die gängigen Schwermetalle wie Blei, Zink, Kadmium, Kupfer. Es gibt Dinge, die sind problematischer und andere, die sind es weniger. Quecksilber haben wir nicht in der Schlacke, die Kadmiumgehalte sind stets im unkritischen Bereich. In Hamburg haben wir seit über 25 Jahren keinerlei Probleme mit kritischen Inhaltsstoffen gehabt.
Recycling und Aufbereitung werden ja immer besser. Kann man die Schlacke nicht auch verbessern?
Da sind wir dran, aber das kostet. Schlacke wird durch aufwendige Reinigungsprozesse deutlich teurer, aber auch umweltverträglicher. Und gegen die Konkurrenzmaterialen wie Natur-Sande oder Schotter hätten wir dann einen preislichen Nachteil. Wir müssen also zusehen, dass wir schon am Anfang vor der Müllverbrennung mögliche Schadstoffe – wie beispielsweise Elektrogeräte – aus dem Müll heraushalten.
Das klingt ganz schön kompliziert.
Wir beobachten die jüngsten Diskussionen um neue Richt- und Grenzwerte. Seit 2012 sind wir mit verschiedenen Forschungsprojekten dabei, die Schlacke in ihre Bestandteile zu teilen. Da schauen wir natürlich als erstes auf die Metalle. Eisen holt man schon seit den Anfängen der Müllverbrennung vor 120 Jahren raus. Das geht auch sehr einfach mit einem Magneten. Das ist ein Selbstgänger.
Aber in der Schlacke steckt ja noch viel mehr als Eisen. Und das wird ja auch rausgeholt.
Stimmt, aber das ist eine recht junge Entwicklung. Erst Anfang, Mitte der 1990er Jahre hat man angefangen auch die Nicht-Eisen-Metalle, also Kupfer, Messing, Zink oder Blei herauszusortieren. Dafür braucht man spezielle Technologien. Diese sogenannten Wirbelstromabschneider waren erst in den 1990er Jahren so weit, dass sie Stoffe aus dem Schlackestrom rausholen konnten. Die Schlacke läuft über ein Förderband und am Ende hat man eine Umlenktrommel, die man so modifizieren kann, dass sie über ein Magnetfeld die Nicht-Eisen-Metalle nach oben rausschleudert. Dann wird eine Trennwand eingesetzt und das Metall von der übrigen Schlacke getrennt. Dieses Verfahren kann man beliebig verfeinern. Mit einem Wirbelstromabschneider lassen sich problemlos die größeren Nicht-Eisen-Metall-Teile herausholen und eine Rückgewinnungsrate von 30 bis 35 Prozent erreichen.
35 Prozent klingt ziemlich mickrig. Mehr geht nicht?
Doch natürlich! Seit 2010 hat es viele technische Verbesserungen gegeben, die höhere Rückgewinnungsraten ermöglichen. Und so gewonnene Metalle schonen die Ressourcen und haben ja einen Wert, da lohnt sich das weitere Aufbereiten. Dabei geht es vorrangig um den Umweltschutz, denn die Trennverfahren sind aufwändig und kosten zusätzliches Geld. Die Verwertungserlöse sollen aber möglichst den Mehraufwand decken. Das sind wir auch unserem Gebührenzahler schuldig. Reich wird man davon aber nicht. Wir haben im Rahmen unserer Forschungsvorhaben gemerkt, dass das, was wir hier in Hamburg betreiben, noch lange nicht das Ende der Fahnenstange ist. Die Anlage in der Borsigstraße hat 2014 nachgerüstet. Die lag vorher bei 35 Prozent - und jetzt erzielt sie vielleicht 70 Prozent.
Bleiben also noch 30 Prozent der Metalle in der Schlacke. Wir asphaltierten also unsere Autobahnen mit Rohstoffen - statt sie in der Kreislaufwirtschaft zu nutzen?
Davon kann man nicht sprechen, wenn wir von einem Anteil der Metalle in der Rohschlacke von rund 10 Prozent ausgehen, das entspricht 2,5 Prozent des Inputmaterials. Die verbleibenden Anteile liegen dann unter einem Prozent und die sind eben technologisch ganz schwer heraus zu bekommen. Hierauf konzentrieren sich die aktuellen Forschungsvorhaben. Im Klartext: Wir lassen rund drei Millionen Euro jährlich in der Schlacke, die wir irgendwann rausholen könnten. Deshalb müssen wir die Anlagen weiter optimieren, doch das würde acht bis zehn Millionen Euro kosten - würde uns aber im Gegenzug jährlich einen Millionenbetrag einbringen und sich somit in absehbarer Zukunft amortisieren. Wir sind uns sicher, dass Hamburg in dieser Sache in den kommenden drei Jahren nachrüsten wird.
Lohnt sich das Geschäft mit Schlacke überhaupt?
Schlacke fällt beim Verbrennungsprozess an. Sie ist also unvermeidbar in einer modernen Abfallwirtschaft. Es geht also nicht darum ob es sich lohnt, wir müssen einfach einen ökologisch vorteilhaften und ökonomisch tragbaren Weg finden. Für uns ist Schlacke ein Zuschussgeschäft. Wir zahlen bei jeder Tonne Schlacke, die wir abgeben, drauf. Es geht für uns also darum, möglichst wenig dazu zu zahlen. Der Abnehmer soll den Baustoff aber auch nicht geschenkt bekommen. Oder gar noch Geld dafür erhalten, sondern schon dafür zahlen. Nur so zeigen wir: Das Produkt hat einen Wert und schont die natürlichen Ressourcen. Die Verkaufserlöse decken nur einen Teil der Aufbereitungskosten. Sie verhindern aber, dass der Bürger für seinen Müll am Ende mehr Gebühren zahlen muss.
In anderen Ländern scheint man da schon weiter zu sein…
In den Niederlanden ist es bereits möglich, Schlacke in Beton reinzumischen. Technisch ist das problemlos möglich, aus wiederverwerteten Stoffen beispielsweise Pflastersteine herzustellen. Das Verfahren hat sich bei unseren Nachbarn seit Jahren bewährt. Ein Drittel der gesamten Schlacke, die dort entsteht, soll künftig zu Pflastersteinen werden. Das ist ein super Ansatz. Und die gehen auch davon aus, dass sie das weiter ausbauen können.
Klingt doch erstmal ganz gut…
Das, was die Holländer machen, ist bei uns zurzeit rechtlich nicht zulässig. Wir wünschen uns natürlich, dass das bei uns auch möglich wird. Denn wir müssen nachhaltiger wirtschaften. In der Realität wird seit gut zehn Jahren über die Ersatzbaustoffverordnung gestritten. Da geht es um unterschiedliche Standpunkte. Für die Grundwasserschützer gilt der höchstmögliche Besorgnisgrundsatz, der jede nur denkbare Beeinträchtigung auch durch Fehler beim Einbau ausschließen will. Es geht dabei auch immer wieder um die festgeschriebenen Grenzwerte. Wenn man nur Eventualitäten hochrechnet und Horrorszenarien entwickelt, steht das im Gegensatz zur Kreislaufwirtschaft. Die Rechnung geht einfach nicht auf. Solange die beiden Seiten nicht in Balance gebracht werden, wird es die in den Niederlanden erreichten Möglichkeiten nicht bei uns geben können.