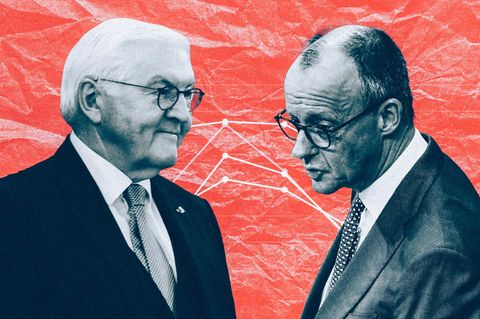Es gibt viel zu tun bis zum Jahr 2020. Dann sollen rund 35 Prozent der Energie grün sein, sprich aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse entstehen. Bis 2050 sollen es sogar 80 Prozent werden. Worum Grüne jahrelang gekämpft haben, ist im vergangenen Jahr unter Schwarz-Gelb gesellschaftlicher Konsens geworden. Doch noch kommen 18 Prozent des Stroms aus Atomkraftwerken, und seit Kurzem feiert auch die Braunkohle ein Comeback. Ob die hehren Ziele erreichbar sind, liegt an der Konkurrenzfähigkeit der erneuerbaren Energien. Wie läuft es beim Ausbau von Strom aus regenerativen Energien? Ein Überblick.
Wie weit ist die Windenergie?
Auf der Winderenergie ruhen die Hoffnungen der Zukunft. Besonders die riesigen Offshore-Windparks in der Nord- und Ostsee sollen in den nächsten Jahren den Großteil der Kernenergie ersetzen. Ziel der Bundesregierung ist es, die bisherige Leistung von Anlagen auf rund 15 Prozent der deutschen Stromproduktion im Jahr 2030 auszubauen. Im vergangenen Jahr lag der Anteil der gesamten Windenergie, inklusive der Windräder auf dem Land, laut AG Energiebilanz erst bei 7,6 Prozent. Der Ausbau stockt. Energieexperten prognostizieren, dass das Ziel um mehr als ein Drittel verfehlt werde. So stehen aktuell erst 50 Offshore-Windräder - bis 2020 sollen es aber 2000 werden. Auch wenn der Bau der Anlagen zügiger voran käme, der Strom könnte bislang kaum genutzt werden. Denn viel Energie wird besonders im Süden Deutschlands gebraucht, der meiste Wind weht jedoch im Norden. Erst müssen noch Transportleitungen gebaut werden. Der für den Norden zuständige Stromnetzbetreiber Tennet rechnet mit Kosten von 15 Milliarden Euro. Weil der Zustand des Netzes aktuell noch so schlecht ist, mussten in den vergangenen Jahren Windparks oft abgeschaltet werden. Das meldete der Bundesverbands der Windenergie. Demnach fuhren die Netzbetreiber 2010 in insgesamt 1085 Einsätzen Windräder herunter - gegenüber noch 285 Einsätzen im Vorjahr. Und die Energie erstmal speichern? Dafür gibt es bislang kaum Möglichkeiten.
Wo steht die Sonnenenergie?
Solarstrom gehört unter Privatpersonen zu den Lieblingsenergieerzeugnissen. Jeder Hausbesitzer könnte sich eine Anlage auf das Dach bauen. Besonders teuer sind Photovoltaik-Module auch nicht mehr, seitdem China die Solarenergie als boomenden Wirtschaftszweig für sich entdeckt hat. Deswegen ist die Förderung von Solarenergie für den Ottonormalverbraucher besonders interessant. Die Bundesregierung hat sich die bislang acht Milliarden Euro kosten lassen, weil sie pro erzeugter Kilowattstunde eine Einspeisevergütung zahlt. Doch richtig effizient ist das nicht. Denn die Sonnenenergie trägt aktuell nur mit drei Prozent zum gesamten Energiemix bei, frisst aber mehr als die Hälfte der Ökoförderkosten. Für den Stromkunden ist das teuer: Die Bürger finanzieren die Kosten per Ökoenergieumlage über den Strompreis. Aktuell sind Anlagen mit einer Leistung von 25.000 Megawatt installiert. Davon kamen rund 7500 Megawatt erst 2011 dazu. Wegen des starken Ausbaus hat die Bundesregierung im Februar die Förderung von neuen Anlagen um bis zu 30 Prozent gekürzt. So erhalten zukünftig Besitzer von kleinen Dachanlagen bis zehn Kilowatt nur noch 19,5 statt 24,43 Cent je Kilowattstunde an Einspeisevergütung. Anlagen bis 1000 Kilowatt bekommen 16,5 Cent, und große Solarparks bis zehn Megawatt erhalten 13,5 Cent. Außerdem wird die Vergütung nach und nach abschmelzen. Das gab es vorher auch schon, jedoch halbjährlich. Nun soll monatlich gekürzt werden, jeweils 0,15 Cent je Kilowattstunde. Den großen Energiehunger der Industrie kann die Solartechnik bislang noch nicht stillen. Großprojekte wie Desertec, also Solarparks in der Wüste, stecken in den Kinderschuhen. Dieses Jahr soll das erste Referenzprojekt in Marokko errichtet werden.
Was macht die Wasserkraft?
Wasserkraft ist unter den erneuerbaren Energien die effizienteste. 90 Prozent der Bewegungsenergie des Wassers lassen sich in Strom umwandeln. Ein weiterer Vorteil: Wasser ist im Gegensatz zu Wind und Sonne nicht so stark vom Wetter abhängig. Die Stromgewinnung lässt sich also besser planen. Weltweit liegt der Anteil von Wasserkraft an der Stromversorgung bei rund 16 Prozent. Damit ist diese Energiequelle mit Abstand die wichtigste unter den regenerativen. Norwegen zum Beispiel deckt seinen Strombedarf komplett über die Energie aus Wasser, Österreich zur Hälfte. In Deutschland fristet sie nur ein stiefmütterliches Dasein. 2011 trug sie zu 3,2 Prozent zur gesamten Stromerzeugung bei. In den Planungen der Bundesregierung kommt sie nur am Rande vor. Laut Konzept zur Förderung der erneuerbaren Energien sollen alle deutschen Standorte für Pumpspeicherkraftwerke erschlossen werden - um in Zukunft überschüssigen Strom aus Solar- und Windenergie zu speichern. Nur in Bayern spielt Wasserkraft eine bedeutendere Rolle. In dem Bundesland gibt es laut Wissenschaftsmagazin "Spektrum" bereits 4000 kleinere Wasserkraftanlagen. Die Landesregierung will noch mehr bauen und den Anteil dieser Energiesorte am bayrischen Strombedarf auf ein Fünftel steigern.
Wie geht es bei der Biomasse voran?
Die Stromerzeugung aus Biomasse ist in den vergangenen Jahren rasant gestiegen, wenn auch auf niedrigem Niveau. 2011 hatte sie laut AG Energiebilanzen einen Anteil von 5,2 Prozent am gesamten Stromoutput. Allein aus der Energie von Biomasse wie bei den anderen regenerativen Quellen wie Sonne und Wind kann kein Strom erzeugt werden. Zunächst muss aus biologischen Rohstoffen Gas gewonnen werden. Das funktioniert beispielsweise mit Bioabfall, Rüben, Mais, Mist oder Gülle. Aus dem Gas wird dann per Blockheizkraftwerk Strom erzeugt - und Wärme. Die kann an die Heizungen der umliegenden Häuser verteilt werden. Energie aus Biomasse hat also einen doppelten Effekt. Sie funktioniert daher auf regionaler Ebene gut. Jedoch werden die meisten Anlagen mit Mais betrieben, weil das einen hohen Energiewert hat. Großer Nachteil: Landwirte bauen immer mehr Mais an, was zu einer "Vermaisung" der Landschaft führt. Und: Die Anbauflächen sind begrenzt. Schließlich werden die Rohstoffe auch als Nahrungs- und Futtermittel genutzt. Nichtregierungsorganisationen laufen bereits Sturm: Die Lebensmittelpreise stiegen und der Anbau von Mais führe zu Monokulturen, kritisieren sie. Die Bundesregierung hat darauf reagiert. Seit Anfang des Jahres sind pro Anlage nur noch 60 Prozent Maisfütterung erlaubt. Der Rest muss aus anderen nachwachsenden Rohstoffen kommen.