Wer hat wann Kontakt mit einem Coronakranken gehabt? Die Beantwortung dieser Frage - das sogenannte "Contact Tracing" - ist eine entscheidende Komponente der Bemühungen, die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen und langsam zu einem normaleren Alltag zurückzukehren. Die Hoffnung der Bundesregierung ist eine App auf Basis des PEPP-PT-Projekts. Doch kann die auf Bluetooth basierende App die Hoffnungen auch erfüllen?
"Es gibt mehrere Ansätze, die oft miteinander verwechselt werden", erklärt Rena Tangens vom Verein Digitalcourage. "In Südkorea setzte man etwa auf die genaue Standortmessung mit GPS. Die hierzulande geplante Variante ist aber vom System in Singapur inspiriert, das völlig anders funktioniert." Statt den genauen Standort zu messen, soll die PEPP-PT-Lösung nur protokollieren, wenn man sich länger in der Nähe anderer Personen aufgehalten hat. Wird dann bemerkt, dass diese Person mit dem Coronavirus infiziert ist, bekommt man eine Warnung – ohne genau zu erfahren, um wen es sich handelt. So sollen Datenschutz und Wirksamkeit vereinbar werden.
Spagat zwischen Genauigkeit und Privatsphäre
Dazu setzen die Entwickler auf die Bluetooth-Technologie. Die Entscheidung erscheint zunächst nachvollziehbar: Bluetooth ist in jedem Smartphone verbaut, die Schnittstelle erlaubt Verbindungen bis zu zehn Metern. Und: Anders als GPS oder die Sammlung von Funkzellendaten ist sie mit dem Schutz der Privatsphäre vereinbar, denn sie erlaubt keine Rückschlüsse über den genauen Standort einer Person – und damit auch keine Überwachung von Bewegungsmustern der Menschen.
Laut dem PEPP-PT-Konsortium sollen die Smartphones der Nutzer sich direkt miteinander austauschen. Wird eine bisher nicht genannte Zeitspanne überschritten, wird ein Token gebildet, in dem der Kontakt der beiden Personen pseudonym, also ohne persönliche Daten, gespeichert wird. Eine universal verfügbare Schnittstelle, die nur auf nächster Nähe funktioniert und keine Verfolgung erlaubt – das klingt zunächst vielversprechend.
Was ist ein "Kontakt"?
Doch ganz so unproblematisch wie vom Konsortium dargestellt ist die Wahl von Bluetooth nicht. "Bluetooth erlaubt keine genaue Aussage, ob Personen tatsächlich Kontakt hatten", so Tangens. Ob Personen sich nahe genug waren, um eine Infektion möglich zu machen, kann ein Smartphone über Bluetooth nicht bewerten. Dazu ist die Technik auch schlicht nicht ausgelegt, erklärt auch Hannes Federrath. Er ist Professor der Universität Hamburg und Präsident der Gesellschaft für Informatik. "Die Technologie soll unkompliziert Geräte miteinander verbinden. Eine Messung der Entfernung war nie vorgesehen."
Die wäre aber eigentlich nötig, um wirklich beurteilen zu können, ob zwei Personen eine Ansteckungsgefahr füreinander dargestellt haben. "Es ist wie mit dem Schall in einem Raum", erläutert Federrath die Verteilung des Signals. "Manchmal hört man entfernte Personen so, als stünden sie neben einem. Und das kann auch mit dem Bluetooth-Signal passieren." Genauso ist es denkbar, dass die Verbindung wegen Störungen nicht zustande kommt, obwohl man direkt nebeneinander steht.
"Bluetooth kann auch dann einen Kontakt anzeigen, wenn man mehrere Meter auseinander steht oder gar auf verschiedenen Straßenseiten. Oder wenn eine Wand oder eine Glasscheibe dazwischen ist. Dann wäre eine Ansteckung quasi ausgeschlossen", merkt Tangens an. Trotzdem würde ein Alarm ausgelöst, der Menschen dann in Quarantäne schickt.
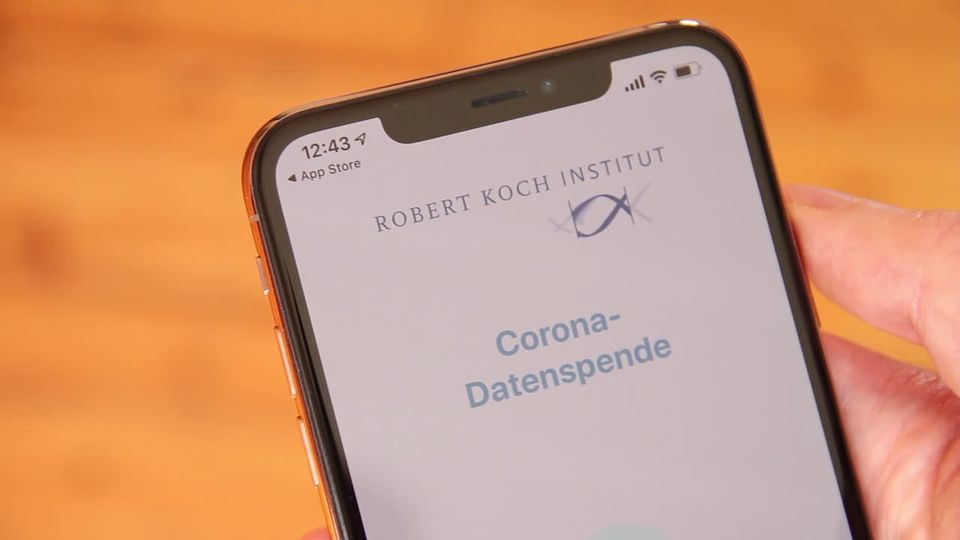
Hürden auf Systemebene
Hinzu kommen Probleme mit der Art, wie Smartphones mit Bluetooth umgehen. Die beiden Betriebssysteme iOS und Android haben hier jeweils eigene Herausforderungen parat. "In einigen Android-Versionen sind Bluetooth und GPS miteinander verknüpft. Man kann Bluetooth nicht einschalten, ohne gleichzeitig die Ortungsdienste einzuschalten – und damit den Standort an Google weiterzugeben", warnt Tangens.
iPhones dagegen erlauben nicht, dass Bluetooth von Apps im Hintergrund genutzt wird. Eine Contact-Tracing-App müsste also ständig im Vordergrund laufen, was unrealistisch ist. Die Entwickler arbeiten nun fieberhaft daran, die Einschränkung zu umgehen.
Eine Lösung könnte direkt von den Herstellern kommen. Google und Apple arbeiten bereits beide daran, Contact-Tracing direkt über das System zu erlauben. Sie ließe sich theoretisch auch als Basis für das PEPP-PT-Projekt nutzen. "Damit die Abstandsmessung plattform- und geräteübergreifend zuverlässig funktioniert, wäre es sehr sinnvoll, Apple und Google mit ins Boot zu holen", glaubt Federrath daher. "Aber das ist natürlich nicht frei von neuen Risiken."
"Die beste schlechte Lösung"
Trotz der Probleme ist der Professor sich sicher: Bluetooth ist von den aktuell verfügbaren Technologien die richtige Wahl. "Es ist die beste schlechte Lösung, die wir aktuell haben", spitzt er es zu. Dabei gibt es durchaus eine geeignetere technische Alternative. "Apple hat mit dem iPhone 11 einen Chip vorgestellt, der die Entfernung zwischen Geräten messen kann, die ihn besitzen", berichtet Federrath. "Das wäre gerade die ideale Technologie. Aber dieser Chip ist nur in wenigen Geräten verbaut. Um möglichst viele Nutzer einzubeziehen, muss eine Lösung gefunden werden, die auch bei 150-Euro-Smartphones funktioniert."
Die Fehleranfälligkeit durch die ungenaue Bluetooth-Messung muss man seiner Ansicht nach in Kauf nehmen. "Es wird falsche Warnungen geben und es werden auch eigentlich nötige Warnungen ausbleiben", gibt Federrath unumwunden zu. "Aber diese Fehler gibt es auch bei einer manuellen Sammlung der Daten. Und es ist immer noch besser, als keine Lösung zu haben."
Rena Tangens ist skeptischer. Sie sieht vor allem den Wunsch nach einer einfachen, technischen Lösung. "Durch die Politik – und auch die Menschen, die sich einen ganz normalen Alltag zurückwünschen – wird die App mit viel zu hohen Erwartungen aufgeladen", vermutet sie. "Die wird sie mit Bluetooth als Grundlage aber nicht erfüllen können. Wenn man einmal eine Nachricht erhält, dass man mit einem Erkrankten Kontakt hatte, geht man sicherheitshalber in Quarantäne. Aber tut man das beim dritten oder vierten Mal immer noch? Die Anfälligkeit für Fehler ist wegen der Ungenauigkeit von Bluetooth eigentlich zu hoch."










