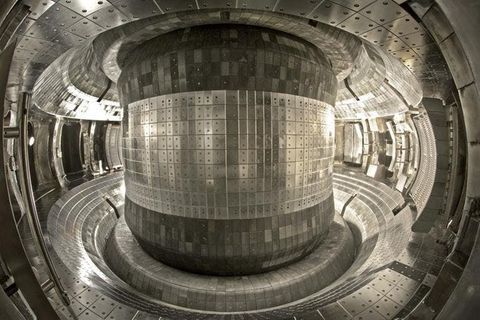Die beste Art den Klimawandel zu stoppen, wäre es, den Ausstoß von CO2 so weit zu reduzieren, bis ein Kohlenstoff-Gleichgewicht erreicht wird. Dann wird nicht mehr CO2 freigesetzt, als gleichzeitig durch Pflanzenwachstum gebunden wird.
Doch davon ist die Welt weit entfernt. Statt weniger wird immer mehr CO2 in die Atmosphäre geblasen. Je größer die Zweifel werden, dass die Bemühungen so das Klima zu retten, ausreichen, umso interessanter werden andere Ansätze. Sie versprechen eine Abkürzung auf dem langen Weg, das Klima zu stabilisieren.
Der Wissenschaftsautor Tim Smedley stellt in seinem Buch "Clearing the Air: The Beginning and the End of Air Pollution" einige dieser Visionen vor. Allen gemein ist eins: Nicht weniger, sondern mehr Technik soll das Klima wieder ins Lot bringen. Anstatt die natürlichen Verhältnisse der Jahre vor 1950 wieder herzustellen, wollen sie ein Klima künstlich neu schaffen – ein Weltklima, das eben kühler ist.
Weniger Sonne, weniger Wärme
Ausgangspunkt vieler Überlegungen ist der Ausbruch des Vulkans Pinatubos auf den Philippinen im Jahr 1991. Er schleuderte Partikel in zehn Kilometer Höhe. Dieser Staubschleier hatte eine merkliche abkühlende Wirkung, er hielt die Sonnenstrahlen fern. Diese Entdeckung führte zu mehreren Konzepten. Die exotischste Idee ist eine Art von gigantischen Sonnenschirmen im Weltall, die der Erde partiell Schatten spenden könnten.
Technisch weniger aufwendige Modelle knüpfen an der Rolle von Eis und Wolken an. Etwa 30 Prozent der Sonnenstrahlen werden derzeit von weißen Oberflächen in den Weltraum zurück reflektiert. Reduziert sich die helle Fläche – etwa durch das Abschmelzen von Eis – verstärkt das den Klimaanstieg noch.
Das offene Meer hingegen reflektiert nur 6 Prozent des Sonnenlichts und nimmt 94 Prozent auf. Solange keine Wolken über dem Wasser sind. Marine Stratocumuluswolken reflektieren einen guten Teil der Sonneneinstrahlung, zudem kühlen sie das Meer. Was also, wenn es gelänge, mehr und weißere Wolken zu erzeugen?
Seit den Siebzigerjahren ist bekannt, dass Schiffe eine Wolkenspur hinter sich herziehen. Der Schmutz aus ihren Schornsteinen wirkt als Kodensationskeim. Um die Partikel herum sammeln sich Wassertropfen. In den 1990er Jahren arbeiteten Stephen Salter, Professor an der University of Edinburgh, und der Atmosphärenforscher John Latham zusammen. Ihr Vorschlag läuft auf eine Art von Wolkenschiffen hinaus. Sie arbeiten wie eine Schneekanone, doch sie sollen natürlich keinen Schnee, sondern weiße Wolken produzieren.
Wolkenkanonen auf dem Meer
Als Kondensationskeim solle natürlich nicht der Ruß des Schiffsdiesels benutzt werden, Salter und Latham wollen Salzpartikel benutzen, die man aus dem Meerwasser gewinnen könnte. Technisch ist das Projekt aufwendiger, als zunächst erwartet, weil Meerwasser auf lange Sicht den Sprühanlagen und besonders den Ventilen zusetzt. Dennoch wären diese Schiffe kein Hightech-Projekt, sondern einfach aufgebaut.
Das neueste Design der beiden ist ein unbemanntes Segelschiff, das einen ultrafeinen Nebel aus Meersalz in Richtung Wolken pumpt. Der inzwischen emeritierte Professor ist ziemlich optimistisch. Salter sagte zu Tim Smedley: "Wenn wir etwa 10 Kubikmeter pro Sekunde sprühen, könnten wir den ganzen Schaden, den wir der Welt bisher zugefügt haben, wieder gutmachen."
300 Schiffchen könnten die Temperaturen demnach weltweit um 1,5 Grad senken. Gleichzeitig könnte der gezielte Einsatz einiger Schiffe die Bildung von Hurrikanen zumindest mildern, wenn sie gezielt die Aufheizung des Meereswassers reduzieren. Das gleiche verspricht Stephen Salter für Phänomene wie El Niño.
Eine Wolkenschiff-Flotte von kleinen autonomen Segelschiffen wirkt noch ziemlich natürlich. Andere Forscher träumen davon, hohe Luftschichten mit Chemikalien zu impfen, dann würde sich ein Schleier bilden, der die Sonneneinstrahlen dort reflektiert, lange bevor sie die tieferen Schichten überhaupt erreicht haben.
Diese Techniken versprechen eine echte Aussicht, den Anstieg des Klimas deutlich zu reduzieren, und das bei vergleichsweise sehr geringen Kosten. Dennoch sind derartige Projekte umstritten und kommen kaum über Laborversuche hinzu. Woran liegt das?
Experiment mit ungewissem Ausgang
Einerseits gibt es eine deutliche Opposition von Klimaforschern und Aktivisten. Sie fürchten, dass der Kampf gegen den Anstieg von CO2 in der Atmosphäre nicht mehr energisch geführt wird, wenn es alternative, billigere und bequemere Methoden gibt. Dann würden weiterhin immer mehr fossile Energieträger verbrannt werden. Anstatt sich mit einer teuren weltweiten Energiewende herumzuschlagen, würde man lieber die Meere mit Wolken einnebeln, Dunst in der äußeren Atmosphäre erzeugen und womöglich auch noch Schattensegel aus Gold in den Weltraum hängen.
Selbst wenn das Vorhaben gelänge, wäre das alles andere als ein natürliches Weltklima in einem natürlichen Gleichgewicht. Wenn das Geo Engineering erst einmal im großen Maßstab begonnen habe, gebe es keine Möglichkeit jemals wieder damit aufzuhören, so die Befürchtung.
Der zweite Ablehnungsgrund liegt in der Technik selbst begründet: Die Forschungen können nur partielle Folgen der Eingriffe vorhersagen. Doch niemand kann die ganzen Auswirkungen dieser Eingriffe auf ein so komplexes System wie das Weltklima prognostizieren. Dass mehr Wolken mehr Sonnenreflexion bedeuten, wird niemand bestreiten. Doch kaum jemand kann garantieren, dass die erwünschte Kühlung der einzige Effekt der Maßnahme wäre und eine forcierte Wolkenbildung über den Ozeanen sonst wirkungslos bleibt. Regenfälle könnten sich ändern, Luftströmungen könnten neue Wege suchen. Vielleicht würden wir schnell in einer Art Schwitzkasten unter einer dichten Wolkendecke leben.