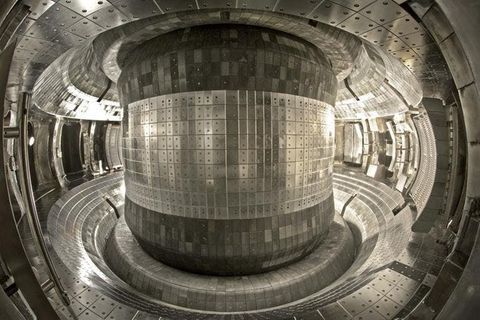Die Erde heizt sich immer mehr auf. Die Ursache: Der Anteil des Treibhausgases CO2 in der Atmosphäre steigt an. Eine der Hauptursachen dafür ist der Verbrauch fossiler Energieträger. Werden Öl und Kohle verbrannt, wird der Kohlenstoff dieser uralten Überreste von Pflanzen zu CO2. Vor etwa einem Jahr startete die erste CO2-Fabrik von Climeworks: Sie kämpft aktiv gegen die Klimaerwärmung, in dem sie CO2 direkt aus der Luft gewinnt und mit dem Gas das Wachstum von Pflanzen in einem angeschlossenen Gewächshaus befördert. Auf dem Dach der Müllverbrennungsanlage in Hinwil (Schweiz) steht die erste Anlage dieser Art.
Die Versprechungen der Gründer Jan Wurzbacher und Christoph Gebald waren groß und offenbar haben sie auch im Praxis-Betrieb nicht enttäuscht. Ein wichtiger Schritt. Denn manche Innovationen überzeugen im Labor, funktionieren dann aber nicht in der Wirklichkeit.
Hier ist es anders. In einer Finanzierungsrunde haben die Gründer von Privatinvestoren und der Zürcher Kantonalbank umgerechnet 26,8 Millionen Euro bekommen. Hinzu kommen Fördermittel. Insgesamt fließen über 43 Millionen Euro in das Unternehmen.
Mit dem Geld soll eine Serien-Produktion der Module ermöglicht werden. Auf diese Weise sollen die Preise im Vergleich zu der quasi in "Handarbeit" hergestellten ersten Anlagen deutlich gesenkt werden.
Die bestehende Anlage filtert 900 Tonnen CO2 im Jahr aus der Umgebungsluft. Das Gas wird dann in ein Gewächshaus umgeleitet. Der Gemüseanbau profitiert von dem Gas, aber in dem Gewächshaus ist keine besondere Technologie notwendig. Das eigentliche Geheimnis ist die Technik, mit der das Gas von der sonstigen Luft getrennt wird.
Unterirdische Lagerung von CO2
Die Anlagen von Christoph Gebald und Jan Wurzbacher bestehen aus Modulen und sind so einfach skalierbar. In den Modulen befindet sich die eigentliche technische Innovation. Ein Ventilator dient zum Ansaugen der Luft. Die wird über den Absorberfilter geleitet, bis das Material gesättigt ist. Der Filter ist das Novum. Er besteht ursprünglich aus Zellulose. Der genaue Aufbau und die chemische Behandlung des Materials sind das Geheimnis der Firma. In der Anlage funktioniert der Filter wie ein Molkelül-Schwamm. Die CO2-Moleküle lagern sich an die Poren an. Nach etwa drei Stunden ist ein Schwamm gesättigt. Der Ventilator stoppt und die Box mit dem Filter schließt sich. Durch Erhitzung und Vakuum wird das CO2 in reiner Form freigesetzt. "Das kann man immer wieder machen", sagt Jan Wurzbacher. "Das ist ein Zyklus von Sättigung und Regeneration." Der Prozess ist also relativ aufwendig. Der Standort wurde klug gewählt, die benötigte Wärmeenergie stammt aus der Müllverbrennungsanlage.
Climeworks ist nicht die einzige Firma, die an der Direct-Air-Capture-Technologie arbeitet. Die Vision hinter der Anlage ist weniger die Hilfe für Gewächshäuser, sondern die Vorstellung, die Ursachen des Klimawandels zu bekämpfen. Macht die Technik weitere Fortschritte wäre es zumindest denkbar, einen signifikanten Teil des emittierten CO2 wieder einzufangen und so ein Klimagleichgewicht herzustellen.
Abgasreduktion muss dabei die erste Priorität genießen, aber schon CO2-Fabriken wie die jetzt erstellte Anlage können einen messbaren Beitrag leisten. Davon sind die Gründer überzeugt. "Leicht skalierbare Technologien um Emissionen rückgängig zu machen sind entscheidend, wenn wir unter dem Zwei-Grad-Ziel der internationalen Gemeinschaft bleiben wollen", sagt Christoph Gebald, Mitbegründer und Geschäftsführer von Climeworks. "Unsere Technologie bietet deutliche Vorteile, um dieses Ziel zu erreichen und eignet sich hervorragend, um mit der unterirdischen Lagerung von C02 kombiniert zu werden. Wir arbeiten daran, bis 2025 ein Prozent der weltweiten CO2-Emissionen zu filtern. Um dies zu erreichen, benötigen wir rund 250.000 Anlagen wie die in Hinwil."