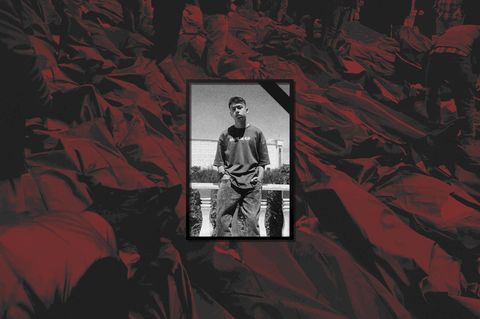Er ist ein Recke ohne Wehr, strotzend, biegsam und fest. Nur die Rüstung fehlt. Ein Zupfen, und schon liegt er im Körbchen. Eidottergelb, nach Mirabellen und Spätsommer duftend, nach würzigem Rehrücken und milden Rühreiern. Ein litauischer Pfifferling, geerntet für die deutsche Pfanne. Zurück bleibt das Wurzelgeflecht, das Myzel, das Fäulnis liebt und sich mit Bäumen paart. Seine Wunde schließt Maria Miskiniené mit beiden Händen, deckt Moos über den Stumpf. Damit nächstes Jahr ein neuer Hände mit dem Messer auf dem Rücken wie zum Gebet. Die alte Frau hat sie, die Gabe, Pilze zu sammeln: "Den Wald zu sehen ist ein Geschenk Gottes."
Pfifferlinge sind ein schnelles Geschäft. Zehn Tage, und der geerntete Pilz ist hin, braun, mit fauligen Rändern oder, schlimmer noch, schleimig. Montags gepflückt, sollten Marias Pilze spätestens samstags im deutschen Supermarkt liegen. Im Körbchen à 500 Gramm, foliert, das Etikett "Pfifferlinge aus Litauen" aufgetackert und das für vier Euro - da könnte glatt ein osteuropäisches Gewächshaus dahinterstecken. Tatsächlich widersteht der Pfifferling allen Zuchtversuchen. Ein Naturprodukt ohne Handelsklassen und EU-Norm. Die Symbiose von Pilz und Wald ist so kompliziert, dass kein Mensch sie versteht. Der Waldpilz an sich ist ein Sonderling. Weder Flora noch Fauna, sondern Funga. Er ist oft giftig, und wenn essbar, dann liegt er schwer im Magen. Am Ende bleibt der Pfifferling, was er ist: ein Rest Wildnis. So wie Südlitauen. Die EU ist hier am Ende. Ein paar Kilometer weiter beginnt Weißrussland, bis dahin nichts als Wald, Wald, Wald. Ein Märchenwald. Mit glänzenden Birken, soliden Eichen, feingliedrigen Kiefern und einem Teppich aus grünem und silbernem Moos, der sich weich und luftig wie ein Bett unter den Füßen wellt. Ein Wald mit sandigem Boden, wie ihn Pilze lieben. Jeden Morgen schließt die 64-jährige Maria Miskiniené die Tür ihres Holzhauses in einem Dorf bei Varéna.
Ein Schmerz, ein Pilz
Sie legt den Schlüssel unter den abgestoßenen Emaileimer am Schuppen, lässt Pumpe und Plumpsklo hinter sich und verschwindet zur Arbeit im Wald. Allein um Litauens Pfifferlinghochburg Varéna gehen täglich 2000 Menschen in die Pilze. "Wenn es im Wald keine Pilze und Beeren gäbe", sagt ein südlitauisches Sprichwort, "müssten die Frauen nackt herumlaufen." Deutschland ist Exportland Nummer eins. Eine Nation von Pfifferlingsverrückten, deren Köche im Sommer Pfifferlingkarten schreiben. Je nach Region heißt der "Cantharellus cibarius" bei uns Rehfüßchen, Rehling, Dotterpilz, Gelbröhrchen oder Eierschwammerl. Gegessen wird er als Ragout oder Pastetenfüllung, in Öl eingelegt oder milchsauer vergoren, in der Kartoffelsuppe oder im Raukesalat - der Pfifferling gibt jedem Essen seine Note: Pfeffer. Gern wird er auch allein in die Pfanne geschickt, nur mit ein bisschen Butter und Salz. Waldwürze pur. In Deutschland ist er eine bedrohte Art, sammeln ist nur für den Privatverzehr erlaubt.
Tausend Kilometer östlich klemmt Maria Miskiniené eine Haarsträhne unters Kopftuch und atmet den Wald ein. Regen war gestern, jetzt drückt die Wärme schwül wie Waschküchenluft. Aprilwetter im August - ein Bilderbuchklima für Pilze. Die Rentnerin läuft zickzack, arbeitet mit Beinen und Blicken, fühlt mit den Augen den Waldboden ab und dann! Tief ins Moos geduckt, das ist kein welkes Birkenblatt! Das ist das gelbe Leuchten! Da helfen Maria Erfahrung und ihre Gabe, die ihren inneren Kompass norden: Waren da im Beerensumpf nicht im vorigen Jahr die vielen Vovereites (Wowereitjes gesprochen)? Sie gabelt Zeige- und Mittelfinger in den Boden, dann kommt der Stich. Autsch. Ganz unten im Rücken. Ein Schmerz, ein Pilz.
Drei Jahre bis Singapur, drei Tage bis Deutschland
Die alte Frau scheitelt das Moos und bringt den Speisepilz ans Licht: ein weiß- bis orangefarbener Dotterpilz mit Lamellen unter dem Hut. Winzlinge, die mit weniger als zwei Zentimetern kaum über die Erde gucken, lässt Maria leben. Die Kaventsmänner bis sechs Zentimeter kommen ins Körbchen. Ein Kilo Pfifferlinge macht abends an der Sammelstelle bis zu zehn Litas, umgerechnet drei Euro. 1500 Litas netto schafft Maria von Juli bis Oktober, so viel wie drei Monatsrenten. Alle drei Jahre geht die Pilzsammlerin mit 4600 Litas ins Reisebüro und kauft ein Ticket nach Singapur, wo die Tochter und die drei Enkel leben. Würde sie beim Pilzesammeln Bonusmeilen sammeln, hätte sie die Strecke in derselben Zeit erlaufen.
Drei Jahre bis Singapur, drei Tage bis Deutschland. Für die Vovereites ist die erste Zwischenstation in Kaunas. Hier hat die Firma "Heiga" ihren Sitz. In dieser Saison macht sie geschätzte 800 Tonnen für Edeka, Rewe und Metro verkaufsfertig. Auf dem Hof gibt Firmenchef Josef Ellert per Handy Pilzpreise durch. Mit akkurater Frisur und hellblauem Hemd sieht er trotz der zehn Jahre Litauen noch ein bisschen nach München aus. Er klagt, dass der Pfifferling nichts mehr wert sei. Vor 15 Jahren kostete ein Kilo noch 25 Mark. Damals kam die Ware aus Österreich und Polen, Anfang der 90er Jahre betrat Litauen den Markt. Die Händler, die dabei waren, sind heute reich, richtig reich. Zwei bis drei Mark Gewinn hat das Kilo damals gebracht. Heute sind es 15 bis 50 Cent. Und dann kam 2004 auch noch der EU-Beitritt und damit der Wohlstand ins Baltikum. Josef Ellert zeigt auf die Verarbeitungshalle, in der er eine Wand gezogen hat: "Die andere Hälfte ist vermietet, weil ich nicht mehr genug Sortiererinnen gefunden habe."
"Wir sind vielleicht nicht die Billigsten, aber die Besten"
Dienstagmorgen um sieben. Frühschicht. Weiße Steinwände in der Halle und 14 Grad. Gestapelte Pilzpaletten, übermannshoch. Es riecht nach Wald und Sauna. Hinter Sortiertischen 60 Kittelfrauen mit Häubchen. Frauen? Schulmädchen! Die Älteren suchen was Festes, keine Saisonarbeit. 500 Gramm bringen 10 Cent. Wer hinne macht, hat am Abend 25 Euro. Taschengeld für Teenieträume. Was sie mit dem Geld machen wird? Klamotten kaufen, sagt die 17-jährige Egle und wendet den Blick zurück auf die Pilze. Früher standen hier Studentinnen, aber die sind ab nach Westeuropa. Simone will auch nach London. Zum Jobben, da kann sie richtig Geld verdienen. Für das Ticket arbeitet sie gut die Hälfte der Sommerferien im Akkord. Monoton flirren die Sortiererinnenfinger über die Pilze: braune, nasse, faule und Bruch müssen raus, die guten kommen ins Körbchen. Den Takt piept die elektronische Waage: sechs Körbe auf eine Kiste, 72 Kisten auf eine Palette, 33 Paletten auf einen Lkw. Zack, zack, zack, und gut sieben Tonnen Pfifferlinge sind unterwegs.
30 Stunden Autobahn noch, dann sind Marias Vovereites in Deutschland. 200 Mitarbeiter braucht Ellert in Kaunas, früher waren es 800. Die Stellen sind über die Grenzen gewandert, nach Russland und Weißrussland, denn von dort steigen die Exporte. Vor sieben Jahren hat Ellert bei Moskau zwei Firmen gekauft. "Wenn’s sein muss, ziehe ich nach Russland", sagt der Pilzmann. Das Geschäft geht weiter. Leichter wird es nicht. Weißrussische Waren haben ein Imageproblem, und das Etikett "russische Pfifferlinge" löst beim Konsumenten Tschernobyl-Alarm aus. Mehr als die zulässigen 600 Becquerel werden in Deutschland selten gefunden. Jeder Pilzhändler weiß, dass er einpacken kann, wenn er belastete Ware verkauft. Um sicherzugehen, leistet sich Ellert ein eigenes Gammaspektrometer für 150.000 Euro und einen vom Institut Fresenius geschulten Mitarbeiter, der jede Lieferung auf Cäsium 137 prüft: "Wir sind vielleicht nicht die Billigsten, aber die Besten." Auch die litauische Ware schickt Musterpilzhändler Ellert in die Bleitrommel - freiwillig. Innerhalb der EU produzierte Lebensmittel müssen nicht getestet werden.
Das Waldgold lässt die Hütte glänzen
Dienstagabend. Zum zweiten Mal kommt Maria heute heim aus dem Wald. Sie schüttet den Korb auf das bunte Wachstuch im Kochschuppen, ein Berg, groß wie der Küchentisch. Früher, sagt sie, gab es mehr Pilze. Damals sind die Leute mit einem Pferdefuhrwerk in den Wald gefahren, und das Moos war gelb wie eine Blumenwiese. Damals. Als die vielen Sammler noch nicht die Myzelien ausgerissen haben, als der Wald dichter und chemiefrei war. Maria erzählt vom Verschwinden der Pilze. Jeder Pilzsammler kennt andere Geschichten. Sicher ist: Immer weniger Litauer gehen in den Wald. Der Enkel der Pilzsammlerin sitzt lieber am Computer, die Tradition stirbt. Aber wenn Maria Mikiniené ihren Korb auf dem Küchentisch ausschüttet, ist es wie früher. Das Waldgold lässt die Hütte glänzen. Dann lächelt Maria, und in ihren Augen scheint für einen Moment die Skyline von Singapur.