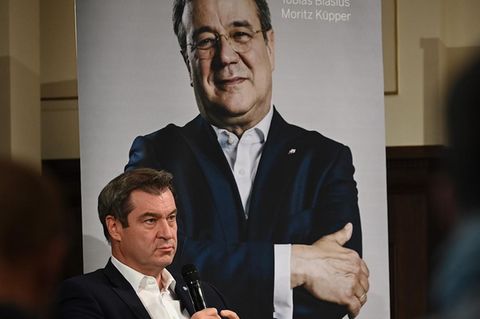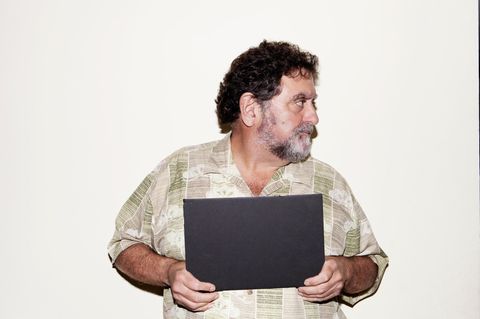Berlin, 1920: In der pulsierenden Hauptstadt arbeitet Friedrich Ritter erfolgreich als Arzt, doch er ist unzufrieden. Als fanatischer Anhänger von Nietzsche will er dessen Philosophie von Geisteskraft und Größenwahn umsetzen - an einem unberührten Ort. Als Dore Strauch 1927 in seine Praxis kommt, ist sie schnell begeistert von seinen Ideen. 1928 schmieden sie Pläne für ein gemeinsames Eden jenseits von Berlin - auch wenn Ritter dafür zunächst keine Frau eingeplant hatte. Doch im Juli 1929 brechen sie zusammen nach Amsterdam auf. Nach Wochen auf hoher See bringt der Schoner "Manuel y Cobos" die beiden an ihr Ziel, ein kleines Eiland vor der Küste von Ecuador - Floreana, eine der vielen Galapagos-Inseln.
Ein nebelverhangener Berg ragt aus den tropischen Wäldern, Vögel umkreisen die Ankömmlinge. Sie landen mit großem Gepäck: darunter zwei Badewannen aus Zink, eine komplette Zimmererwerkstatt, Draht, Seile, Dachpappe und mehr als zehn Zentner Pflanzen und Samen, hundert Meter Baumwollstoff und Besteck und Geschirr aus Nirosta, das gerade in Deutschland auf den Markt gekommen war. Im üppig bewachsenen Krater eines erloschenen Vulkans finden Friedrich und Dore ihre neue Heimat. Sie bauen ein Haus und legen einen Garten an. Durch ihr Paradies laufen sie gerne nackt wie Adam und Eva, bis drei Jahre später eine Frau auf die Insel kommt, die sie für eine bösartige Schlange halten.
Die Welt steckt um 1930 in der Wirtschaftskrise
Eloise Baronin Wagner de Bousquet betritt 1932 die Insel mit achtzig Zentnern Zement im Gepäck - und einem Gefolge von vier Männern. Zwei davon sind ihre Liebhaber. Gemeinsam wollen sie eine "Hacienda Paradiso" auf Floreana bauen, ein Luxushotel für Millionäre, die auf ihren Kreuzfahrten über die Meere behagliche Ruhe finden sollen. Die Idee ist nicht abwegig. Seit Friedrich und Dore Berlin verließen, bringen die Zeitungen große Geschichten von "Adam und Eva auf Galapagos". Selbst die "New York Times" berichtet. Die Welt steckt um 1930 in der Wirtschaftskrise. Da ist der deutsche Garten Eden für die Leser eine willkommene Insel der Glückseligen.
Die Zeitungsartikel locken immer wieder Abenteuerlustige an. Die meisten verlassen die Insel auf einem der vorbei kommenden Schiffe wieder, entnervt vom anstrengenden Kampf ums Überleben. Nur eine kleine Familie bleibt: Heinz Wittmer ist Mitarbeiter von Konrad Adenauer, zu dieser Zeit Oberbürgermeister von Köln, bis er mit Frau und Kind auswandert. So bekommen auch die Wittmers hautnah die Ankunft der Baronin mit.
"Revolution auf einer Pazifikinsel"
In der brütenden Sonne von Floreana erzählt die platinblonde Lebedame von ihrer Herkunft. Sie sei die Tochter eines österreichischen Amtsträgers, der in den Nahen Osten geschickt worden war, um den Bau der Bagdadbahn zu überwachen. Ein anders Mal versicherte sie, im Ersten Weltkrieg eine Agentin gewesen zu sein, um später in Konstantinopel als Tänzerin aufzutreten. Dort habe sie ihren französischen Ehemann namens Bousquet kennen gelernt, der in ihrer Entourage allerdings fehlt. Dore bezweifelt, ob die Baronin überhaupt adlig ist. Besonders entsetzt ist sie vom Lebenswandel der Baronin. Ihre beiden Liebhaber seien "die Sklaven dieser Frau. Das ging so weit, dass sie beide in einem Bett mit ihr schliefen, wenn sie es befahl." Das Paradies hat seine Unschuld verloren.
Bereits während die Baronin von ihren Männern das Insel-Anwesen bauen lässt, gibt es Streit. Mal badet sie ihre geschundenen Füße im Trinkwasserbecken von Friedrich und Dore, dann lässt sie den Lastesel der einstigen Berliner entführen. Die Kölner Familie Wittmer muss dagegen um einen Sack Reis kämpfen, den ein Schiff für sie lieferte. Die Baronin zückt ihren Revolver und verlangt einen saftigen Aufpreis. Während Wagner de Bousquet Hof hält, schreibt sie Berichte, in denen sie sich als Kaiserin von Galapagos bezeichnet, und schickt sie an Zeitungen. Ihr Mythos wird in Schlagzeilen auf der ganzen Welt verbreitet: "Revolution auf einer Pazifikinsel. Frau ruft sich zur Kaiserin aus!"
Selbst Franklin D. Roosevelt ermittelt
Der Unfrieden ergreift alle. Die beiden Liebhaber der Baronin prügeln sich. Auch Dore und Friedrich vertragen sich nicht mehr. Nietzsche-Anhänger Friedrich lässt seine Verachtung für Frauen immer wieder an seiner Geliebten aus. Zudem setzt der extreme Sommer 1934 allen Siedlern zu. Da überschlagen sich die Ereignisse. Die Baronin verschwindet - zusammen mit einem ihrer Liebhaber. Angeblich auf einem Schiff, das aber niemand gesehen hat. Kurz darauf wird der zweite Liebhaber auf einer Nachbarinsel tot aufgefunden. Der Arzt Friedrich Ritter stirbt unterdessen an einer Fleischvergiftung.
Was in dieser Zeit geschieht, ist bis heute nicht geklärt. Reporter recherchieren, Untersuchungskommissionen ermitteln. Selbst der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt, wohl ebenso von den Sensationsberichten angelockt wie andere, macht auf einer Kreuzfahrt vor Floreana Halt und befragt die überlebenden Bewohner. Auch er kann die Wahrheit nicht finden.
Die Siedler warfen sich selbst aus dem Paradies
Als Jahrzehnte später ein Biologe der Universität Cambridge, John Treherne, bei seinen Forschungsreisen auf Galapagos vom untergegangenen deutschen Garten Eden hört, ist er so fasziniert, dass er seine Naturstudien ruhen lässt und das Buch "Verloren im Paradies - Die Galapagos-Affäre" schreibt. Treherne geht davon aus, dass der Nebenbuhler die Baronin und ihren Liebhaber ermordete und auf der Flucht ertrank: "Falls ihm jemand dabei half, war es mit hoher Wahrscheinlichkeit Friedrich Ritter." Der Arzt hasste die Baronin besonders.
Später starb der mögliche Mittäter an vergiftetem Fleisch, so glaubt Treherne, das seine von ihm verachtete Geliebte Dore kochte. "Die Tragödien von Floreana", schreibt Treherne, "waren in erster Linie Folge des Hasses, der sich innerhalb der Siedlergruppen aufstaute und nicht unbedingt die des Konkurrenzkampfes zwischen den Parteien." Die deutschen Siedler von Floreana warfen sich selbst aus dem Paradies.
Liebe Leser, leider hat sich in diesen Text ein Fehler eingeschlichen. Bei dem hier erwähnten US-Präsidenten handelt es sich um Franklin D. Roosevelt und nicht um Theodore Roosevelt. Wir bitten die Verwechslung zu entschuldigen, d. Red.