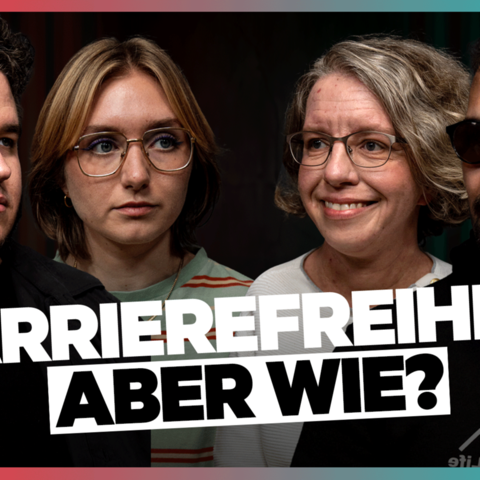Damit Anna-Luisa Maischberger die Haustüre vollständig öffnen kann, fährt sie mit ihrem Rollstuhl wenige Meter zurück. Den Elektrorollstuhl hat sie vor drei Jahren, zu Beginn des Studiums, bekommen. Mit dem Studium begannen auch die Probleme: Der Kampf mit dem Amt um Zuschüsse für den Fahrdienst und ein umgebautes Auto, in dem sie den Führerschein machen könnte. Ein Kampf für mehr Teilhabe, Selbstständigkeit und Freiheit. Ein Kampf, in dem die 22-Jährige aus Hamburg nach vielen Monaten der Verzweiflung und vielen Ablehnungsbescheiden kürzlich einen kleinen Fortschritt für sich verbuchen konnte. Doch dazu musste sie erst einen Anwalt einschalten. "Nur weil ich mehr Freizeitaktivitäten wahrnehmen möchte. Ein Armutszeugnis für die Stadt", findet sie.
Hohes Verletzungsrisiko in Bus und Bahn
Bevor Anna-Luisa Maischberger mit dem Studium begonnen hat, saß sie in einem Aktiv-Rollstuhl, den sie selbst oder eine andere Person anschieben musste. Die 22-Jährige ist kleinwüchsig und hat die Glasknochenkrankheit, ist also auf das Gefährt angewiesen. Ebenso ist sie auf andere Menschen angewiesen, die sie im Auto von A nach B transportieren. Das hat hauptsächlich ihre Mutter übernommen. Öffentliche Verkehrsmittel kommen für die Rollstuhlfahrerin nicht in Frage. "In Bus und Bahn ist das Verletzungsrisiko zu hoch", sagt sie.
Mit Beginn des Studiums sollte sie "flexiblere Beförderungsmöglichkeiten erhalten." So steht es in einem Schreiben des Amts für Eingliederungshilfe Hamburg-Wandsbek, das für die junge Frau zuständig ist. Anna-Luisa Maischberger "gehört aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen zu dem Kreis der Personen, die Leistungen zur Mobilität erhalten". Das heißt, dass die Beförderung und die Fortbewegungsmöglichkeiten der 22-Jährigen finanziell unterstützt werden.

Neben einer monatlichen Beförderungspauschale von 120 Euro gewährte das Amt ihr Zuschüsse für einen Fahrdienst in Höhe von 2.170 Euro pro Monat. Letzterer Betrag entspricht laut dem Bescheid des Amtes "zehn Einzelfahrten pro Woche zum Studienort und zurück und zwei Einzelfahrten in der Woche zu Lerngruppen". Für Freizeitaktivitäten solle sie die Beförderungspauschale nutzen. "Bei meinem Fahrdienst kostet eine Fahrt 50 Euro", erklärt Anna-Luisa Maischberger. "Mit 120 Euro kann ich im Monat also zwei Fahrten machen." Zwei Fahrten, ein Hin- und ein Rückweg – sprich, einen Ausflug im Monat. Für die Hamburger Behörde offenbar ausreichend. Die Beförderungspauschale sei "für die Teilnahme an privaten Veranstaltungen etc. im Rahmen der Sozialen Teilhabe" gedacht, teilt eine Sprecherin der Behörde mit. Der stern hat das zuständige Bezirksamt Wandsbek mit einem ausführlichen Fragenkatalog konfrontiert. Während die behördlichen Abläufe und Hintergründe ausführlich erläutert worden sind, fielen die Antworten, die den Fall von Anna-Luisa Maischberger betreffen, knapp und einsilbig aus.
Im Rollstuhl hinter dem Steuer – dafür bräuchte es ein umgebautes Auto
"Mein größter Wunsch ist es, so selbstständig wie möglich zu sein", sagt Anna-Luisa Maischberger. Sie wolle selbst fahren lernen und einen Führerschein machen. Ein verkehrsmedizinisches Gutachten bestätigt ihr, dass sie dazu in der Lage ist. Allerdings bräuchte die 22-Jährige einen eigens für sie umgebauten Wagen. "Mit einem eigenen Auto wäre ich vollkommen unabhängig. Könnte zur Uni, zu Freunden oder spontan in den Urlaub fahren", zählt die Studentin auf. Ihre Mutter nickt. "Sie hätte Flexibilität, Eigenständigkeit und eine Sicherheit, die sie sonst nicht kriegen würde", fügt sie hinzu.
Bei dem Wagen müssten unter anderem die Rückbänke und der Fahrersitz raus – die 22-Jährige würde in ihrem Rollstuhl am Steuer sitzen – der Boden müsste angeglichen und eine Rampe eingebaut werden. Fahren würde sie mit Hilfe von zwei Joysticks. "Auf der einen Seite wären Gas und Bremse, auf der anderen das Lenkrad", erklärt sie. Alles weitere, wie zum Beispiel Blinker, ginge via Sprachsteuerung.
Die Gesamtkosten für diese Arbeiten würden sich auf circa 136.683 Euro belaufen. Mit dem Kostenvoranschlag stellte die 22-Jährige den entsprechenden Antrag auf Finanzierung des Autos. Bis die Rollstuhlfahrerin eine Antwort erhielt, verging mehr als ein Jahr. Nach langem Warten hatte sie schließlich einen sechsseitigen Ablehnungsbescheid in der Post.
"Keine erweiterten Teilhabemöglichkeiten"
Stattdessen gewährte die Behörde ihr zusätzlich zum Fahrdienst eine Summe von 16.000 Euro "zur Anschaffung eines PKW sowie dessen behindertengerechten Umbau". Damit hätte sich die Familie einen Wagen zulegen und eine Rampe einbauen lassen sollen, damit Anna-Luisa Maischberger weiterhin von ihrer Mutter befördert werden kann. Dies sei laut dem Amt die wirtschaftlichere Option. Auf die Dauer des Studiums gerechnet würde aber allein der Fahrdienst circa 164.880 Euro kosten. Zusammen mit den 16.000 Euro kommt ein Betrag zusammen, der den Kostenvoranschlag von 136.683 Euro deutlich übersteigt. "Hier irrt das Amt", sagt Nikolaus Mohr, Anwalt mit Schwerpunkt Behindertenrecht. Der Jurist vertritt Anna-Luisa Maischberger seit April. Ein weiterer Irrtum: "Das umgebaute Kfz bringt Frau Maischberger keine Unabhängigkeit von der Assistenz", steht im Ablehnungsbescheid. Für den Studienalltag habe die 22-Jährige zwar eine Assistenz, Auto fahren könne sie aber eigenständig. "Dass ich immer in Begleitung sein muss, stimmt nicht", sagt sie.

Hinzu kommt laut der Hamburger Behörde die "unklare Situation hinsichtlich des Erwerbs des Führerscheins". Das Amt könne sich nicht sicher sein, ob Anna-Luisa Maischberger den Führerschein besteht. "Weil ich erst das Auto brauche, um darin dann den Führerschein machen zu können", erläutert sie. Klar ist für die Studentin jedoch, dass ein eigener Wagen ihr viel mehr Möglichkeiten bieten würde, ihre Freizeit zu gestalten und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Das Amt behauptet im Ablehnungsbescheid jedoch, dass eigenständiges Fahren "keine erweiterten Teilhabemöglichkeiten" verschaffe. "Soziale Teilhabe ist für Frau Maischberger auch durch die gewährten Leistungen sowie die Nutzung als Passivfahrerin gewährleistet", heißt es von der Behörde. Zwar sei die Finanzierung eines eigenen Wagens laut Rechtsanwalt Mohr ein komplizierter Fall, doch "wenn sie die Möglichkeit hätte, den Führerschein zu bestehen und Auto zu fahren, ist das ein Bestandteil der sozialen Teilhabe."
"Soziale Teilhabe" ist Definitionssache
Das Recht auf soziale Teilhabe erwächst einerseits aus dem Grundgesetz und ist andererseits im Sozialgesetzbuch festgeschrieben. "Wenn die junge Frau eigenständig fahren kann, ist das eine unglaubliche Erweiterung der Teilhabe", findet auch Ulrike Kloiber, Senatskoordinatorin für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in Hamburg. Das Amt hat von dem Begriff der "sozialen Teilhabe" aber eine andere Auffassung. "Das Problem bei Gesetzen ist, dass die Behörde einen gewissen Ermessensspielraum hat", erklärt Rechtsanwalt Mohr. Da jede Behinderung unterschiedlich sei, gehe es immer um Einzelfallentscheidungen. "Dabei gibt es diesen Ermessensspielraum, den der Gesetzgeber der Behörde einräumt." Die genaue Beurteilung dessen, was unter "Teilhabe" fällt, hänge von jeweiligem Sozialarbeiter oder Richter ab, der die Entscheidung treffe.
Diese Entscheidungen beruhen laut dem Amt auf einem "umfangreichen Verfahren". Damit gemeint sind unter anderem Gutachten, mit denen die Behörde "den Umfang der benötigten Unterstützung" einschätzt. Dafür werde "die Landesärztin bzw. das Beratungszentrum Sehen-Hören-Sprechen-Bewegen beauftragt". In der Regel sollte es sich um Untersuchungen handeln, bei der die betroffene Person persönlich begutachtet wird, sagt Rechtsanwalt Mohr. Dies bestätigt auch das Amt.
"Aufgrund der Corona-Situation in den letzten Jahren waren diese persönlichen Termine allerdings eher die Ausnahme", heißt es von der Sprecherin. Ein Nachteil für die betroffene Person, so der Jurist. "Meist ist es so, dass man erst bei einer ambulanten Untersuchung den vollen Umfang der Beeinträchtigung feststellen kann", sagt er. Anna-Luisa Maischberger ist manchmal telefonisch befragt worden. Manchmal seien aber auch Gutachten ohne ihr Wissen – sogenannte Gutachten nach Aktenlage – erstellt worden. Persönlich vorgeladen wurde sie nie. Eine Tatsache, die sie enorm stört. "Die sehen nur hundert Prozent Behinderung auf dem Papier und ziehen daraus ihre Schlüsse", klagt die 22-Jährige.
Nur noch zwei Fahrten im Monat
Als die junge Frau beschloss, den Studiengang zu wechseln und ein Urlaubssemester zu nehmen, fiel das Geld für den Fahrdienst weg. Übrig blieb ihr die Beförderungspauschale von 120 Euro, zwei Fahrten im Monat also. Anna-Luisa Maischberger stellte Anträge auf weitere Zuschüsse für mehr Freizeitfahrten. Doch das Amt lehnt jedes Mal ab. Lediglich wenn sie ehrenamtlich tätig würde, könnten ihr "Fahrten zur Wahrnehmung des Ehrenamtlichen Engagements" bezahlt werden. "Familienfeiern, Freunde treffen, Theater – das fällt alles nicht darunter", zählt die Studentin auf. "Ich werde total isoliert." Inklusionsbeauftragte Kloiber bezeichnet diese Entscheidung als "schwierig". Dass das Ehrenamt als Bedingung für eine Beförderung vorausgesetzt wird, habe sie noch nie gehört.

Nach Angaben des Amts sei dies der "unterschiedlichen Auslegungen des vorgegebenen Entscheidungsspielraums" geschuldet. In diesem Fall habe man das Ehrenamt "als Voraussetzung für die Gewährung einer erhöhten Leistung gesehen". Gegen diesen Bescheid hat Rechtsanwalt Mohr Widerspruch eingelegt: Die Behörde habe Ermessensspielraum falsch ausgelegt, argumentiert er. "Meine Mandantin möchte soziale Kontakte wahrnehmen, Freizeitinteressen nachgehen, persönliche Angelegenheiten erledigen und es ist nicht erforderlich, dass das im Zusammenhang mit dem Ehrenamt steht", stellt der Jurist klar. Eine neue Sachbearbeiterin, die sich dem Fall angenommen hat, gab dem Anwalt Recht. Seitdem erhält Anna-Luisa Maischberger neben der Beförderungspauschale 380 Euro zusätzlich, insgesamt 500 Euro pro Monat für private Fahrten. Ein kleiner Sieg in dem jahrelangen Kampf mit den Behörden, über den sie Studentin sehr froh sei.
"Hamburg ist sicher nicht die einfachste Behördenstadt"
Ein Teil der Belastung sei damit von ihr abgefallen. "Es ärgert mich, dass keiner darüber nachdenkt, was es psychisch mit dir macht, immer Anträge zu stellen, die dann abgelehnt werden", sagt die 22-Jährige. Schon für den normalen Bürger sei es kompliziert, gegen gewisse Entscheidungen vorzugehen. "Für Menschen, die eine Behinderung haben, ist es umso schwerer", sagt ihr Anwalt. Besonders schwer sei es in der Stadt Hamburg, weiß der Jurist, der bundesweit tätig ist, aus seinen Erfahrungen: "Hamburg ist sicher nicht die einfachste Behördenstadt." Die Kommunikation mit dem Amt beschreibt er als "äußerst problematisch".
Das liege daran, dass das Fachamt für Eingliederungshilfe überlastet sei und dementsprechend langsam arbeite. Der Anwalt sah sich des öfteren zu einer Untätigkeitsklage gezwungen. Ein juristisches Mittel, das er anwenden könne, wenn die Behörde nach sechs Monaten nicht über einen Antrag entschieden hat. "Die Familien leiden unter dem verzögerten Arbeiten des Fachamtes", berichtet Nikolaus Mohr. Das ging so weit, dass manche seiner Mandanten umgezogen seien, beispielsweise nach Nordrhein-Westfalen. "Ich weiß, dass es in anderen Bundesländern zum Teil viel schneller geht: In Baden-Württemberg, in Bayern und auch in den östlichen Bundesländern", zählt er auf.
Betroffene sollten persönlich begutachtet werden
Die "erheblichen Verzögerungen" führt das Amt auf die Umstrukturierung zurück. Mit Umsetzung des Bundesteilhabegesetz haben sich die Zuständigkeiten und Verfahren im Jahr 2020 geändert. Die Umsetzungsphase sei aufwendig gewesen und es habe an Personal gefehlt, erklärt die Sprecherin des Amts. Die Gesamtsituation habe sich inzwischen verbessert. Mit Besetzung der offenen Stellen "gelingt es zunehmend, die Verzögerungen in der Antragsbearbeitung zu verringern", versichert das Amt.
Für Ulrike Kloiber liegt das größere Problem in der Begutachtung nach Aktenlage. "Wenn die betroffene Person damit nicht zufrieden ist, wäre es pragmatisch, eine persönliche Begutachtung vorzunehmen", erläutert die Inklusionsbeauftragte. Selbst in Corona-Zeiten und auch wenn das Amt sehr eingespannt sei, müssten solche Ausnahmen möglich sein, meint sie. "Jede Behinderung ist verschieden und sollte deshalb individuell betrachtet werden", fordert sie. Damit könne sich die Behörde viel Ärger und solche "hausgemachten Probleme" ersparen. Eine Verbesserung, die Ulrike Kloiber bei kommenden Terminen vor Ort in den Ämtern anregen wird.
Gesellschaft behindert die Menschen
Für den Fall von Anna-Luisa Maischberger könne es noch weitere Lösungsansätze geben. Die Senatskoordinatorin erwähnt die Inklusionstaxen der Stadt, die ähnlich wie ein Fahrdienst funktionieren, pro Fahrt aber nur 20 Euro kosten. Damit könnte die Studentin einige Fahrten mehr unternehmen. Rechtsanwalt Mohr schlägt in Sachen Auto und Führerschein ein Gespräch mit dem Amt vor. Wenn die Behörde dazu bereit sei, könne man gemeinsame mögliche Alternativen abklären. Doch dazu wird es so schnell nicht kommen. "Das Widerspruchsverfahren bezüglich der Ablehnung der Finanzierung eines Komplettumbaus des KfZ ist abgeschlossen und der Bescheid hierzu ist bestandskräftig", lautet die knappe Antwort des Amtes.

Anna-Luisa Maischberger müsste einen erneuten Antrag stellen, damit das Verfahren wieder aufgenommen wird. Das wird die Studentin in Zukunft auch tun. Ihre Situation habe sich dank der Zuschüsse verbessert, aber "das ist natürlich nicht die maximale Freiheit und Unabhängigkeit, weil ich immer noch auf den Fahrdienst angewiesen bin". Mit möglichst wenig Unterstützung und möglichst viel Eigenständigkeit zu leben – das sei ihr "höheres Ziel". Dafür braucht es in den Augen der Inklusionsbeauftragten schlichtweg individuelle Lösungen. "Behinderung kann man nicht der Einzelperson zuschieben, sondern es sind auch wir als Gesellschaft, die behindern", betont Ulrike Kloiber. "Wenn wir in einer inklusiven Gesellschaft leben wollen, müssen wir uns anschauen, an welchen Stellen das passiert und dort ansetzen."