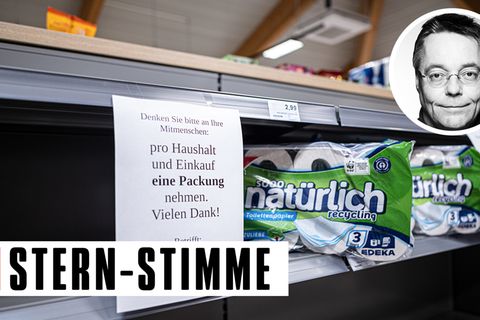Der zivilisierte Mensch reinigt zweimal am Tag seine Zähne. Genauso selbstverständlich wäscht er sich jeden Tag. Zusammengerechnet wenden wir täglich wohl mindestens 20 Minuten für die Körperhygiene auf.
Eine vergleichbare Hygiene für den Geist kennen wir in unserer Kultur nicht. Da sind wir ähnliche Barbaren, wie es unsere Altvorderen im Mittelalter in Sachen Körperhygiene waren. Vor 300 Jahren war noch nicht bekannt, wie wichtig Händewaschen ist, um Krankheitsübertragung zu vermeiden – ähnlich wie uns heute nicht klar ist, dass es Geisteshygiene braucht, um uns vor schlechten Einflüssen zu schützen. Schmutzige Körper und belegte Zähne stinken, ein ungeordneter Geist nicht. Aber er hat Auswirkungen: auf unser Befinden, unsere Handlungen, unsere Mitmenschen.
Strukturveränderungen im Gehirn
Im Moment scheint die Unordnung in unseren Köpfen niemanden zu stören. Sie herrscht ja bei fast jedem, ähnlich wie im Mittelalter, als auch fast jeder ungewaschen durch die Gegend lief. Die Bedeutung geistiger Hygiene, beispielsweise eine Zeit der aktiven Stille und Meditation, oder der bewusste Umgang mit Information, zeigt sich an einigen wissenschaftlich gut belegten Tatsachen.
Denn unser Gehirn ist ein immens plastisches Organ. Bis ins hohe Alter passt es sich an. Alles, was wir oft tun, hinterlegt seine Spuren im Gehirn. Wenn jemand Jonglieren lernt, sind schon nach einer Woche Strukturveränderungen nachweisbar in den Arealen, die sich mit Körpermotorik und -koordination befassen. Auch Menschen, die eine Art Geisteshygiene betreiben, zum Beispiel indem sie regelmäßig meditieren, weisen spezifische Veränderungen im Gehirn auf. Areale, die für die Regelung von Aufmerksamkeit zuständig sind, prägen sich bei ihnen stärker aus, aber auch solche, die die Befindlichkeit des Körpers repräsentieren oder die mit der Regulation von Emotionen befasst sind.
Mit schlechten Gewohnheiten brechen
Das sind wissenschaftliche Hinweise darauf, dass es nicht egal ist, was wir in unseren Köpfen treiben. Vermutlich liegt hier sogar der Schlüssel für unser Wohlbefinden.
Harald Walach ist Professor für Forschungsmethodik komplementärer Medizin und Heilkunde an der Europa-Universität Viadrina
Es wird Zeit, dass wir der geistigen Hygiene so viel Aufmerksamkeit widmen wie der körperlichen: 20 bis 30 Minuten täglich. Die Zeit dafür können wir leicht gewinnen, indem wir mit ein paar schlechten Gewohnheiten brechen. Statt zum Beispiel Zeit im Internet zu verplempern, können wir uns eine neue konstruktive Gewohnheit für die geistige Hygiene zulegen. Man kann damit anfangen, jeden Tag zu einer bestimmten Zeit auf den eigenen Atem zu achten. Beobachten, wie er kommt und geht, sonst nichts. Anfangs fünf Minuten, später mehr. Wenn dabei -Gedanken kommen, macht das nichts, solange Sie immer wieder zum Atem zurückkehren.
Wenn Sie diese Praxis einen Monat lang durchgehalten und ihre wohltuende Wirkung erfahren haben, werden Sie merken: Mit der geistigen Hygiene ist es wie mit dem Zähneputzen. Wer sich einmal daran gewöhnt hat, mag es nicht mehr missen.