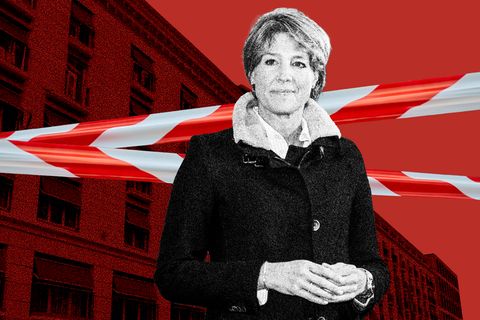Eigentlich war es zu erwarten. "Dies ist genau das Boot, mit dem Madiba von der Insel in die Freiheit fuhr", verkündet stolz der fast zahnlose Kapitän, während sich mehr als 100 Touristen in der prallen Sommersonne über die Gangway an Bord des betagten Schleppers begeben. Sie haben zuvor in einer Halle gewartet, die an die Abfertigung auf dem Flugplatz von Lahr in der deutschen Provinz erinnert, samt Metalldetektor und obligatem Foto unter dem "Robben-Island-Tour"-Schild. Die wenigsten wissen, dass Nelson Mandela, Symbolfigur des Kampfes gegen die Apartheid in Südafrika, nach jahrzehntelanger Haft auf der Gefängnisinsel Robben Island 1988 von dort nicht in die Freiheit entlassen, sondern in ein Gefängnis auf dem Festland verlegt wurde und erst zwei Jahre danach freikam.
Aber wer auf Robben Island, einer kargen Felseninsel rund zwölf Kilometer vor Kapstadt, inhaftiert war, muss es wohl als Freiheit empfunden haben, sobald er von dort weg durfte. Heute drängen sich die Touristen, um diese weltweit bekannte Insel zu sehen. Im Internet muss das Ticket für die Überfahrt Tage im Voraus gelöst werden, wenn keine Pauschalreise - mit Horrorschauer inklusive - gebucht wurde.
SIEH DIE WELT
Der stern veröffentlicht regelmäßig Reportagen von SIEH DIE WELT - dem digitalen Magazin für globale Momentaufnahmen abseits des täglichen Nachrichtenstroms. Subjektiv. Multimedial in Wort, Bild und Ton. Die Autoren von SIEH DIE WELT sind ausgebildete und erfahrene Journalisten. Die beiden Gründer Markus Huth und Oliver Alegiani haben unter anderem für Spiegel Online und die Financial Times Deutschland gearbeitet. Das Magazin finanziert sich durch die Unterstützung seiner Leser.
"Wir dienen mit Stolz"
Nelson Mandela, von den Schwarzen in Südafrika liebevoll Madiba genannt, ist nicht nur Symbolfigur des Freiheitskampfes. Er ist mehr als ein halbes Jahr nach seinem Tod mehr denn je Touristenattraktion. Für die Gefängnistouristen wurde eigens ein Abfertigungsgebäude im Hafen von Kapstadt errichtet mit Nelson-Mandela-Museum, Nelson-Mandela-Café und Nelson-Mandela-Souvenirshop. Hier gibt es die üblichen Andenken, Basecaps, T-Shirts, Polohemden, Schlüsselanhänger, Kaffeebecher - alle entweder mit dem Konterfei des Freiheitskämpfers oder dem modernen Emblem der berüchtigten Insel. Und die Touristen kaufen gerne. Sie sind zumeist Ausländer, zumeist weiß und wollen eine Ahnung vom Horror mitnehmen, den auch Konzentrationslager vermitteln. Schwarze Touristen sind eher selten. Der Ausflug kostet 250 Rand pro Person, nach derzeitigem Kurs knapp 18 Euro - aber für südafrikanische Verhältnisse beileibe kein Schnäppchen.
Auf der Insel angekommen zeigt sich sofort, wer hier früher das Sagen hatte. "Wir dienen mit Stolz", verkündet das Wappen der Gefängnisverwaltung auf Englisch und Afrikaans im Hafen. Nur die Angestellten der Justiz empfanden ihre Präsenz wohl als dienen. Für die Häftlinge war es Leiden.
Ungeschützt der Witterung ausgesetzt
Im Hafen warten klimatisierte Busse auf die Besucher, für jeden Gast ein Sitzplatz. Auf der Insel ist es im Sommer brütend heiß, vor allem, wenn kein Wind geht, im Winter hingegen empfindlich kalt. Nur die ausnahmslos weißen Wachen hatten die Möglichkeit, sich vor dem Wetter zu schützen. Die, ebenfalls ausnahmslos, farbigen Häftlinge - es gab keinen einzigen weißen Gefangenen auf Robben Island - waren der Witterung ungeschützt ausgesetzt. Sie mussten in den Massenzellen auf dünnen Matten schlafen. Und auch die Einzelzellen boten nicht annähernd den Komfort, den Europäer aus Berichten über ihre Haftanstalten kennen. Mit der Ankunft verloren die Häftlinge - nicht alle waren verurteilt, manche nur "interniert" - ihre Identität. Sie waren nur noch eine Nummer. Mandela trug die Nummer 466/64, Gefangener 466 aus dem Jahr 1964.
Lesen Sie auf der nächsten Seite: Wie der studierte Jurist Mandela darauf bestand, dass seine Mithäftlinge sich weiterbilden sollten
Der Gefangene 677/72
Manthatebe ist 1,65 groß und untersetzt. Er war Nummer 677/72 und führt heute die Besucher durch den Zellentrakt. Er ist irgendwann zurückgekommen. Und heute ist er einer der wenigen Bewohner der Insel, die geblieben sind, zumindest auf Zeit. Die meisten von ihnen sind schwarz und alle frei. Sein Leben als Häftling verschafft Manthatebe heute einen bescheidenen Lebensunterhalt. Am Wochenende fahren die Inselbewohner meist mit einer Fähre aufs Festland, auch zum Einkaufen. Einen Laden wie früher gibt es schon lange nicht mehr. Auch die Schule wurde geschlossen aus Mangel an Kindern. Die Kirche ist noch in Betrieb.
Nummer 677/72 erzählt von der Plackerei in den Steinbrüchen. Wie die grelle Sonne auf dem weißen Kalkstein reflektierte und Augenschäden verursachte. Davon, dass die Arbeit nach einer Zeit Selbstzweck wurde, weil die Steine wohl nicht mehr gefragt waren. Er erzählt von der Mandela-Universität, die sich unter den Gefangenen etablierte, weil der studierte Jurist Mandela darauf bestand, dass seine Mithäftlinge sich weiterbilden sollten. Er sah in ihnen zumindest zum Teil die zukünftige Elite eines freien und gleichen, von Schwarzen regierten Südafrikas. Die Häftlinge lernten in der Freizeit und prüften sich gegenseitig während der Arbeit oder den Appellen im großen Hof oder in den Gemeinschaftszellen.
Nächster Stopp: Fotopoint
Manthatebe erzählt ohne Groll. Madiba, der in einer vier Quadratmeter großen Zelle lebte, habe immer den Ausgleich gesucht. Er war der Überzeugung, nur der Starke könne auch vergeben. Die Zelle ist das begehrteste Fotomotiv, die Warteschlange lang. Manthatebe erzählt von kargen Essensrationen, von der Sehnsucht, die der Tafelberg auslöste, wenn man ihn denn sehen konnte. Und er erzählt mit Stolz von einer Leidenszeit, die sich die Besucher heute nur schwer vorstellen können.
Die Besucher drängen bald schon ins Freie, denn der nächste Stopp ist ein "Fotopoint" auf der knapp 550 Hektar großen Insel in der Tafelbucht. Handy hoch, Lächeln, Selfie vor der malerischen Kulisse des Tafelbergs. Der Nächste, bitte! Hier sieht man auch die Robben und einige Pinguine. Ein "Snackpoint" nebenan bietet Popcorn, Eiscreme, kalte Getränke und Postkarten an, die man am Hafen in einen besonderen Briefkasten stecken kann. Die Führerin schaut auf ihre Uhr. Sind alle da? Hat niemand etwas vergessen? Gut. Aufbruch.
Robben Island
Die Unesco hat Robben Island zum Weltkulturerbe erklärt. Auch nach Nelson Mandelas Tod im Dezember 2013 bleibt die Insel eine Attraktion für Touristen. Das Museum von Robben Island bietet hier eine virtuelle Tour an.
Die Busse fahren nicht ganz bis zum Hafen. Ein kleiner Fußweg bleibt, vorbei an den Kanonen, die an die Zeit erinnern, als Robben Island vorgeschobene Garnison war, mit einem letzten Blick auf Stacheldraht und Grabhügel. Wer will, muss jetzt seine Gedanken sortieren oder sehr viel später. Die Rückfahrt auf einer recht rauen See mit Spritzwasser auf dem Oberdeck und intensivem Menschengeruch unter Deck lässt dazu keine Gelegenheit.
Der stern veröffentlicht regelmäßig Reportagen von SIEH DIE WELT - dem digitalen Magazin für globale Momentaufnahmen abseits des täglichen Nachrichtenstroms. Subjektiv. Multimedial in Wort, Bild und Ton. Die Autoren von SIEH DIE WELT sind ausgebildete und erfahrene Journalisten. Die beiden Gründer Markus Huth und Oliver Alegiani haben unter anderem für Spiegel Online und die Financial Times Deutschland gearbeitet. Das Magazin finanziert sich durch die Unterstützung seiner Leser.