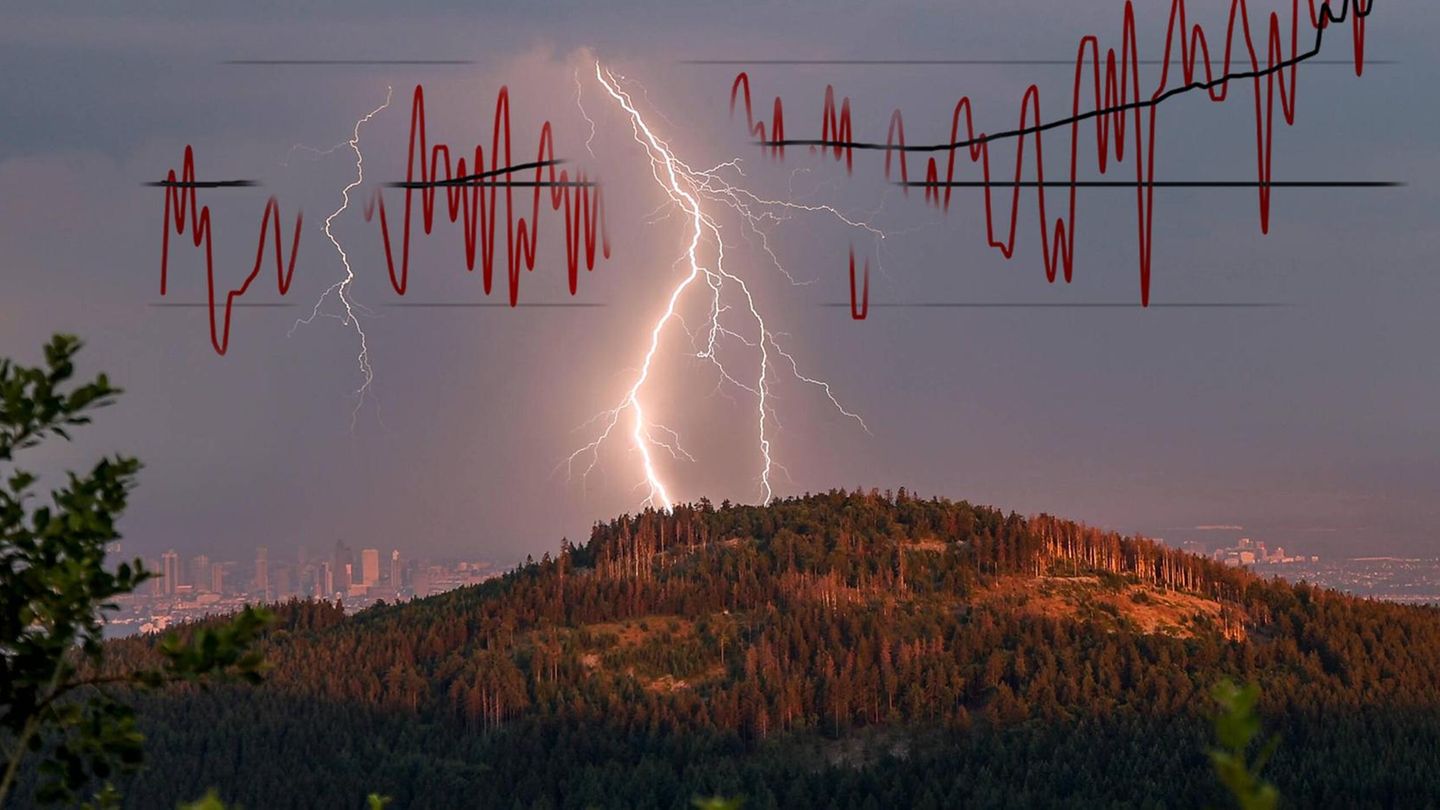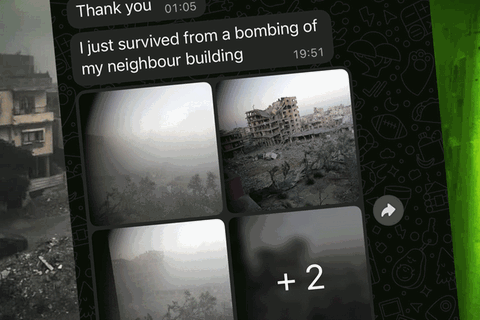1986 platzt eine Meldung in den deutschen Wahlkampf, genauer gesagt ein Papier mit brisantem Inhalt: Es handelt davon, dass die Verbrennung von billigem Öl und Gas Unmengen an Kohlenstoff freisetzt. Genug, um eine globale Hitzewelle auszulösen, die sämtliche Klimaschwankungen der vergangenen 100.000 Jahre in ihrer Intensität, aber auch in ihrer Geschwindigkeit in den Schatten stellt. Geschrieben hat es eine Forschergruppe der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) und Deutschen Meteorologischen Gesellschaft (DMG). Gelandet ist es beim Ministerium für Technik und Forschung, das die Ergebnisse vor der anstehenden Bundestagswahl aber um keinen Preis veröffentlicht sehen will.
"Die Politiker wollten eine Debatte über Klimaänderungen durch den Menschen auf jeden Fall verhindern – und das ist ihnen auch gelungen", erinnert sich Hartmut Graßl, der an dem Dokument mitgearbeitet hat und heute zu Deutschlands führenden Klimaforschern zählt. Als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates Globale Umweltveränderungen hat er die Bundesregierungen in den 1990er-Jahren in Klimafragen beraten.
Seitdem hat sich viel verändert: Deutschlands Gesetze zur Einspeisung von Windenergie (1993) und Erneuerbarer Energie (2000) wurden zu internationalen Vorbildern. Seit 2015 ist das Klimaabkommen von Paris der Maßstab sämtlicher politischer Entscheidungen. Das Bewusstsein über den menschengemachten Klimawandel und seine Folgen ist, auch wegen einer hartnäckigen Klimabewegung, massiv gewachsen. Erneuerbare Energien boomen, selbst in kohlegeprägten Ländern wie China. Die grüne Wende, so sehen es Ökonomen und Klimaforscher, ist mittlerweile unumkehrbar.
Unumkehrbar bleibt aber auch die Richtung, in die sich die Temperatur des Planeten bewegt: Immer mehr Ökosysteme steuern auf ihre Kipppunkte zu, erste Inselbewohner müssen ihre Heimat wegen des steigenden Meeresspiegels verlassen; Extremhitze und Starkregen erschüttern Europa und Deutschland im Wechsel.
Dabei warnten die Wissenschaftler bereits in den 1980er-Jahren: "Es besteht der begründete Verdacht, dass schon innerhalb der nächsten 100 Jahre die mittlere Temperatur an der Erdoberfläche durch Anreicherung an Kohlendioxid um 1,5 bis 4,5 °C (...) ansteigen wird." Werde die Energiewende nicht sofort eingeleitet, könnten die Temperaturen im 21. Jahrhundert um bis zu vier Grad ansteigen. Bestätigt wurden ihre Prognosen in den folgenden Jahren unter anderem vom Weltklimarat IPCC.
Zum 15. Extremwetterkongress, der in dieser Woche in Hamburg stattfand, hatten die Wissenschaftler von DPG und DGM ihre Prognosen überarbeitet, mit dramatischen Erkenntnissen: Stand jetzt könnte die globale Durchschnittstemperatur schon Mitte dieses Jahrhunderts um drei Grad angestiegen sein. Anders gesagt: Die globale Temperatur könnte sich in den kommenden 25 Jahren so stark erhöhen wie in den vergangenen 150 Jahren zusammen.
Was bedeutet das für Deutschland? Ein Blick auf die Wettergeschichte der Bundesrepublik:
Heiß, heißer, Deutschland
2015 einigte sich die Weltgemeinschaft darauf, den Temperaturanstieg dauerhaft auf 1,5 Grad verglichen mit der Referenzperiode vor 1990 zu begrenzen. Ein Jahrzehnt war kaum vergangen, da wurde das Ziel bereits gerissen, womöglich sogar dauerhaft.
In Deutschland dürfte die 1,5-Grad-Grenze längst obsolet sein: Das Land zählt weltweit zu den Hauptverursachern der Pro-Kopf-CO₂-Emissionen, zahlt dafür aber auch spätestens seit diesem Jahrzehnt die Quittung. Verglichen mit dem Rest der Welt erhitzt sich die Bundesrepublik doppelt so schnell. Die Jahre 2022 bis 2024 waren laut Deutschem Wetterdienst (DWD) die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Zudem waren seit den 1960er-Jahren alle Dekaden wärmer als die vorherigen. So weit muss man in der deutschen Wettergeschichte aber nicht zurückgehen, um festzustellen, dass sich die zehn wärmsten Jahre in Deutschland alle in diesem Jahrhundert ereignet haben.
"Eine derart außergewöhnliche Häufung von Rekordjahren der Temperatur ist nur durch die menschengemachte globale Erwärmung erklärbar", heißt es in dem Bericht, den die Physikalischen und Meteorologischen Gesellschaften zusammen mit dem DWD vorgestellt haben. Insgesamt, so hat es der DWD errechnet, liegen die Temperaturen heute um gut drei Grad über denen des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Eine Trendwende ist nicht in Sicht.
Dass sich Deutschland so stark erwärmt, hat allerdings weniger mit seinem Kohlenstoffausstoß zu tun, als mit seiner geografischen Lage. Landmassen speichern Wärme besser als Gewässer. Aktuell ist Europa der globale Hitzehotspot – kein anderer Kontinent erwärmt sich stärker. Und Deutschland liegt mittendrin.
Das hat seit den 1950er-Jahren dazu geführt, dass es in der Bundesrepublik deutlich sommerlicher geworden ist. Zumindest zeigt die Statistik, dass sich die Zahl der Sommertage seitdem verdoppelt, die Zahl der Hitzetage sogar vervierfacht hat. Auch wochenlange Hitzewellen haben zugenommen.
Am stärksten sind laut dem DWD-Report süddeutsche Städte wie Mannheim, München und Nürnberg betroffen. Aber auch Norddeutschland muss sich spätestens seit Mitte der 1990er-Jahre an steigende Temperaturen gewöhnen.
Extremwetterereignisse treten häufiger auf
Wird der weltweite Emissionsausstoß nicht weiter reduziert, warnen die Meteorologen, werde die Zahl der warmen bis heißen Tage weiter zunehmen. Hohe Temperaturen sind besonders für ältere Menschen, kleine Kinder, Schwangere und Erkrankte gefährlich. Kein Extremwetterereignis verursache so viele Todesfälle wie Hitze, schreibt der DWD. Im Sommer 2025 sollen einer britischen Studie zufolge 24.400 Menschen in europäischen Städten aufgrund hoher Temperaturen gestorben sein. Allein in Deutschland sollen es ungefähr 2500 gewesen sein, schätzt das Robert Koch-Institut.
Mit ihrem Bericht bestätigen die deutschen Meteorologen erneut, dass der Klimawandel die Zahl der Extremwetterereignisse erhöht und sie verschärft. Dürren zählen in Deutschland mittlerweile genauso zur neuen Klimarealität wie steigende Waldbrandgefahr, Starkregen und Überschwemmungen.
Ein trauriges Beispiel ist die verheerende Ahrtalflut (2021), die Untersuchungen nicht nur mangelhafter Vorbereitung auf solche Ereignisse zuschreiben, sondern in Teilen auch dem Klimawandel. Dass sich solche Ereignisse in Europa und Deutschland häufen, zeigen auch die massiven Überschwemmungen in Süddeutschland und Nachbarländern wie Österreich im Frühsommer 2024. Die zwölf Monate zuvor waren laut DWD als die niederschlagsreichsten in die deutsche Wettergeschichte eingegangen. Abgelöst wurden sie vom nächsten Extrem: Zwischen Februar und Mai 2025 wurden so wenig Niederschläge wie nie zuvor gemessen, wie es in dem Report heißt.
In der Langzeitbeobachtung sind diese Schwankungen keine Besonderheit, weil Dauer- und Starkniederschläge sehr unregelmäßig auftreten. Wie der Klimawandel sie beeinflusst, wird derzeit noch erforscht. Forscher vermuten, dass Starkregenereignisse tendenziell häufiger stattfinden. In Deutschland "ist diese Zunahme aber für viele Stationen derzeit nicht statistisch signifikant", heißt es dazu vom DWD.
Signifikant ist dagegen der steigende Meeresspiegel an den deutschen Küsten. In Cuxhaven soll er seit 1990 um mehr als 25 Zentimeter gestiegen sein, in Warnemünde um mehr als 20 Zentimeter. "Dadurch erhöhen sich die Wasserstände an unseren Küsten deutlich. Auch Sturmfluten werden vor diesem Hintergrund heftiger ausfallen", warnt der Präsident des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, Helge Heegewaldt. Bei steigenden Emissionen könnte bis zum Jahrhundertwechsel noch einmal ein halber bis ein ganzer Meter dazukommen.
Ohne den Küstenschutz wären schon jetzt weite Teile der Nordseeküste überschwemmt, Hamburg inklusive, wie Daten des norddeutschen Küsten- und Klimabüros am Helmholtz-Zentrum Hereon zeigen. Klimaforscher Hartmut Graßl weist darauf hin, dass schon jetzt die Deiche für Küsten- und Hafenstädte wie Hamburg kaum noch ausreichend seien. "In naher Zukunft müssen wir über große Sperrwerke nachdenken", sagt er.
Forscher trotz Klima- und Wetteränderungen optimistisch
Steigende Temperaturen, steigender Meeresspiegel: Aufhalten lässt sich das alles längst nicht mehr, selbst wenn sämtliche Emissionen von heute auf morgen gestoppt würden, wären die Folgen noch Jahrzehnte spürbar. Die Meteorologen und Klimawissenschaftler sind trotzdem optimistisch. Wenn die Energiewende weiter fortschreite wie bisher, und immer mehr Länder ihren Treibhausgasausstoß reduzierten, dann ließe sich in Zukunft Schlimmeres verhindern. Wenn dann noch in Hitze- und Küstenschutzmaßnahmen investiert würde, wäre schon viel gewonnen.