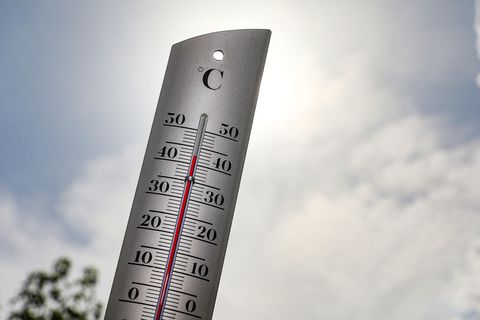Dieser Juli geht in die Wettergeschichte ein: Die Starkregenereignisse Mitte des Monats hatten "ein historisches Ausmaß", wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag nach der ersten Auswertung seiner rund 2000 Messstationen bilanzierte. Der "Jahrhundertregen" kostete mindestens 179 Menschen das Leben. Demnach hat es in Deutschland im Juli 2021 deutlich mehr geregnet als üblich.
In diesem Monat fielen bundesweit im Mittel rund 110 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Laut DWD sind das knapp 40 Prozent mehr als im Schnitt der Referenzperiode 1961 bis 1990. Verglichen mit der Periode 1991 bis 2020 lag das Plus bei fast 25 Prozent.
DWD: Juli-Flut eine der folgenreichsten Naturkatatrophen seit Sturmflut 1962
Schon in der ersten Monatshälfte habe es "regional heftige, teils auch gewittrige Niederschläge samt Überflutungen" gegeben, berichteten die Meteorologen. Mit Tief "Bernd" änderte sich Mitte des Monats die Wetterlage und damit "die Intensität und Großflächigkeit der Regenfälle". Das Besondere daran war, dass der Starkregen nicht mehr lokal niederprasselte, sondern auf einer großen Fläche.
Der Regen zwischen Kölner Bucht und Eifel war derart heftig, "dass dieser als 'Jahrhundertregen' in die meteorologischen Geschichtsbücher eingegangen ist", bilanzierte der DWD. Die verheerenden Fluten waren laut DWD "eine der für Deutschland folgenreichsten Naturkatastrophen seit der Sturmflut 1962".
Wipperfürth-Gardeweg: Mehr als 160 Liter Regen pro Quadratmeter
Über 100 Liter pro Quadratmeter kamen während des Unwetters am 13. und 14. Juli innerhalb von 24 Stunden vom Himmel. Den höchsten Tagesniederschlag einer DWD-Station übermittelte Wipperfürth-Gardeweg bei Köln mit 162,4 Litern pro Quadratmeter. Am 17. Juli öffnete "Bernd" seine Schleusen im Chiemgau und Berchtesgadener Land. Auch dort fielen 24-Stunden-Mengen von teils über 100 Litern pro Quadratmeter. Mit über 350 Litern pro Quadratmetern gab es in dieser Region auch den in Summe größten Monatsniederschlag.
Der Juli 2021 war aber nicht nur deutlich zu nass, sondern auch etwas zu warm und zu wenig sonnig. Der Temperaturdurchschnitt lag im Juli 2021 mit 18,3 Grad um 1,4 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Damit traf er zugleich genau das Mittel der aktuellen - wärmeren - Periode 1991 bis 2020. "Damit war der Monat sogar kühler und wenig sommerlicher als der Juni", berichtete der DWD in Offenbach.
Flut im Westen, Hitze im Osten
Sommerfeeling kam vor allem in den östlichen Bundesländern auf. Dort zählte man die meisten warmen Tage. Brandenburg schaffte im Flächenmittel zwei bis drei Tage mit Höchstwerten von über 30 Grad. Sechs heiße Tage gab es in Berlin-Tempelhof. Der Tageshöchstwert aber kommt aus Bayern und wurde am 6. mit 32,8 Grad in Rosenheim gemessen. Die westlichen Landesteile blieben dagegen von Hitze verschont.
Am tiefsten sackte das Quecksilber am 21. Juli im sächsischen Deutschneudorf-Brüderwiese im Erzgebirge, wo einstellige 4,3 Grad gemessen wurden.
Mit 200 Sonnenstunden verfehlte die Sonnenscheindauer im Juli ihr Soll. Verglichen mit der Periode 1961 bis 1990 waren das rund fünf Prozent zu wenig. Im Vergleich zur Periode 1991 bis 2020 betrug die negative Abweichung sogar zehn Prozent. "Besonders die westlichen Landesteile zeigten in der Sonnenscheinbilanz ein großes Defizit", berichtete der Wetterdienst. Nur 170 Sonnenstunden wurden dort gezählt, der Nordosten kam dagegen auf durchschnittlich 230 Stunden.