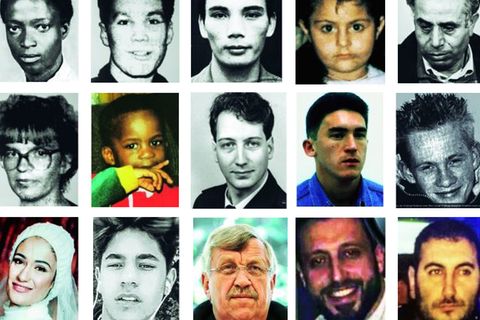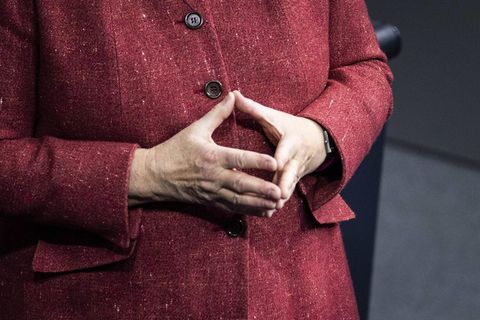Als meine Großeltern heirateten, hatten sie keine Wahl. Ihre Väter arbeiteten bei der Bahn. Sie verabredeten sich. Mariechen und Willi, fünf Jahre Altersunterschied, das passte. Es hielt zusammen, mehr als 50 Jahre; gepasst hatte es nie. Meine Großeltern hatten es sich nicht ausgesucht. Sie suchten sich ja ohnehin nichts aus: ihre Liebe, ihren Beruf, ihren Wohnort, ihren Arzt, ihren Glauben, ihren Lifestyle, ihren Telefonanbieter, ihre Community, ihre Peergroup und keinen Therapeuten. Die Kirche blieb im Dorf, die Ansprüche waren gering. Sie machten alle paar Jahre ein Kreuz auf dem Wahlzettel mit einer Pause zwischen 1933 und 1949. Meine Großeltern kannten Deutschland und Österreich, und die einzige große Reise meines Opas war der Krieg. Ob er nach Polen wollte, wurde er nie gefragt. Er protestierte nicht. Er hatte keine Wahl.
Als meine Eltern heirateten, durften sie wählen. Sie kannten das Leben, aber nur ein bisschen. Sie heirateten früh, meine Mutter war 22. Das war 1960. Mein Vater brauchte nicht zum Militär, weil es ausnahmsweise keines gab. Dafür konnte er studieren und wurde Designer, was es in Deutschland noch nicht gab. Das Land wurde reicher und reicher. Die 60er Jahre kamen, und Oswald Kolle klärte die Republik auf. Aus dem Pflichtfach Sex wurden Kür und Wahl. Meine Eltern reisten durch Westeuropa bis nach Marokko, flogen nach Südkorea und Vietnam. Sie versuchten ein alternatives Leben und trennten sich von den Werten ihrer Eltern. Sie traten aus der Kirche aus, kauften ein Eigenheim am Stadtrand, kamen in die Midlife-Crisis, erhielten eine Antenne für ein zusätzliches Drittes Fernsehprogramm und eine Fernbedienung. Sie freuten sich, dass sie in ihrem Leben wählen konnten, und scheiterten daran, dass es am Ende doch nicht ging.
Frei wählen und aussuchen
Als ich Abitur machte, gab es in Deutschland die ersten Videorekorder. Das war 1984. Telefone hatten noch eine Schnur und gehörten der Post. Das Land wurde immer noch reicher. Aber es gab eine Lehrlingsschwemme und schlechte Berufsaussichten auch für Studierte. Ich konnte meinen Studienort frei wählen und bald auch zwischen zehn Fernsehprogrammen. Ich konnte reisen, wohin ich wollte, nach 1990 sogar in den Osten. Ich musste lernen, einen Computer zu bedienen. Ich konnte mir meine Liebe aussuchen, meinen Beruf, meinen Arzt, meinen Glauben, meinen Lifestyle, meinen Telefonanbieter, meine Community, meine Peergroup und, wenn ich gewollt hätte, meinen Therapeuten. Ich war frei und bekam meine ersten grauen Haare. Der Schutzfaktor der Sonnenmilch hat sich verzehnfacht, die Klimakatastrophe ist Gewissheit geworden. In den Zeitungen und Büchern kann man lesen, dass der Öko-Crash nicht mehr aufzuhalten ist. Im Fernsehen gibt es Überbevölkerung, Migration und die Kriege um die natürlichen Ressourcen. In der Welt vor dem Bildschirm aber merkt man nichts davon. Die Menschen sehnen sich noch immer nach mehr: nach einem Maximum an Liebe und Sex, an Glück, an Gesundheit. Sie wollen prominent sein, schlank und niemals alt. Der gemeine Deutsche des Jahres 2008 denkt noch immer mehr über den Klingelton seines Handys nach als über den Klimawandel.
Die Freiheit der Wahl hat uns träge gemacht, banal und blind. Wir wählen nicht mehr zwischen Ideologien, sondern zwischen Betriebssystemen. Wir haben gelernt, unser Wissen auszuhalten, dass die Welt einem Desaster entgegengeht - wir nehmen es nicht persönlich. Wir können damit leben, wenn uns Moralapostel den Verlust der Werte predigen, der konservativen und der linken. Wir beruhigen uns damit, dass wir immerhin noch besser sind als unsere Jugend. Wir haben noch Disziplin, zumindest manchmal. Und wir empfinden ein Verantwortungsgefühl für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt, zumindest theoretisch.
Was ist nur aus uns geworden? Wir wollen nicht zurück in die Zeit unserer Großeltern und nicht voran in die düstere Zukunft. Wir haben geträumt von einer endlosen Gegenwart. Wir haben geträumt, dass unsere Aktien steigen, ohne dass die Zeit vergeht. Doch nun müssen wir etwas lernen. Dass unsere Aktien nicht mehr steigen werden und dass die Zeit schneller läuft. Wir lernen, dass wir unser Leben nicht auf eine Bank bringen können, die immer höhere Zinsen zahlt.
Richtige und falsche Werte
In dieser Lage entdecken viele Deutsche die Philosophie. Für meinen Großvater war Kant jemand, mit dem er preußische Tugenden verband: Moral, Anstand, Pflicht. Leidvermeidung statt Lustgewinn. Gelesen hat er Kant nicht. Meine Eltern lasen Marx und Adorno. Sie wünschten sich eine Welt, die sich von den Zwängen der kapitalistischen Warenwelt befreit. Sie glaubten nicht mehr daran, dass mehr Konsum mehr Glück bedeutete. Und wenn mein Vater das Wort "Freiheit" oder "freie Welt" hörte, dachte er an die Verbrechen der Amerikaner in Vietnam. Meine Eltern und meine Großeltern wussten, welche Werte sie für richtig und für falsch hielten. Auf der Bühne der Weltpolitik gab es die Guten und die Bösen. In ihrem eigenen Leben war das nicht anders.
Und heute? Sind wir noch immer die Guten? Wäre die Welt ein besserer Ort, wenn alle so leben würden wie wir? Vielleicht gäbe es weniger Folter, und vielen Frauen in der islamischen Welt ginge es besser. Die Vorstellung aber, dass in China eine halbe Milliarde Menschen Auto fährt, lehrt uns das Fürchten. Interventionskriege führen, Rohstoffreserven verbrauchen, Energievorräte aufbrauchen, Klima verpesten - all das sollen nur wir dürfen. Der kategorische Imperativ des Immanuel Kant, dass man so handeln solle, wie man selbst behandelt werden will, gilt nur innerhalb der westlichen Welt - er gilt nicht für jedermann.
Die moderne Welt mit ihrer globalen, mausklickschnellen Informationstechnologie rückt die Menschen nicht nur enger zusammen. Sie verändert auch unser Selbstwertgefühl. So träge wir auch sein mögen: Wir wissen immerhin viel zu viel, um uns noch länger arglos für gut zu halten. Wir wissen, dass unsere Lebensweise den Planeten ruiniert. Zum ersten Mal in der Geschichte sind wir gezwungen, unser Bedürfnis nach "Mehr" infrage zu stellen. Gibt es nicht noch etwas anderes? Etwas Wichtigeres?
Ratgeber verbessern das Leben nicht
Doch wer gibt uns Rat in den Zeiten der Orientierungslosigkeit? Die Kirche, die Yogis, Oshos und Gurus, die Ratgeber mit der schnellen Glücksformel? Jahr um Jahr setzt der deutsche Buchmarkt einen vermutlich dreistelligen Millionenbetrag um allein mit Ratgebern. Wir wollen schöner werden, begehrenswerter, reicher, gesünder, glücklicher. Doch gelingende Liebe ist nur sehr selten eine Frage von Tricks. Durch tausend todsichere Karrieretipps ist noch keiner Chef geworden. Die ungezählten Anleitungen zum Millionärsdasein haben die Millionärsquote in Deutschland nicht signifikant erhöht. Dass man durch die Lektüre schlauer Bücher schlanker wird, ist auch zu bezweifeln. Und liegt mein Lebensglück tatsächlich in einem verborgenen Ich? Was ändert sich in meinem Leben, wenn ich von Benediktinerpater Anselm Grün erfahren habe, aus meinen "klaren Quellen" zu schöpfen, statt aus meinen "trüben"?
Unsere beispiellose Freiheit hat uns nicht nur glücklich gemacht. Tag für Tag zeigt sie uns zugleich, was wir nicht haben. Sie nötigt uns zur Wahl, zum Vergleich, zu Eifersucht, Neid und Frust. Wenn das Leben unserer Großeltern scheiterte, lag es an den Umständen. Wenn unser Leben nicht das ist, was wir uns wünschen, so liegt es an uns selbst. Eine finstere Bedrohung.
Die Emanzipation hat die Frauen glücklich gemacht. - Nur glücklich? Hat sie ihnen nicht zugleich unlösbare Probleme bereitet? Wie bekommt man Beruf und Kinder unter einen Hut? Wie ist man Mutter, sexy und Karrierefrau zugleich? Die sexuelle Revolution hat uns von Scham, Kleinmut und Ballast befreit. Aber hat sie uns nicht auch unerfüllbar wählerisch gemacht? Hat sie unsere Ansprüche nicht ins Unrealistische getrieben? In der Bundesrepublik Deutschland wird jede dritte Ehe geschieden, in den Großstädten sogar jede zweite. Und ein Großteil der Paare kommt in dieser Statistik gar nicht vor - die vielen Paare ohne Trauschein. Die schöne neue Arbeitswelt ermöglicht uns Quer- und Seiteneinstiege in ungekannter Zahl. Zugleich aber nimmt sie uns die Sicherheit, drängt uns in Minijobs und drückt die Löhne. Das Fernsehen der drei Programme vereinte früher die Familie und die Nation. Das Fernsehen der 300 Kanäle trennt die Eltern von den Kindern, die Freunde und die Nachbarn.
Freiheit als Rechtsgrundlage
Die Vordenker unserer Freiheit ahnten noch nichts davon. Für die englischen, französischen und deutschen Philosophen der Aufklärung war Freiheit ein strahlendes Ideal. Sie war der Kampfbegriff gegen die Privilegien des Adels. Das Bürgertum des 18. Jahrhunderts verband die wirtschaftliche Freiheit mit der politischen Freiheit. Die britischen Moralphilosophen John Locke und Adam Smith, die Franzosen Diderot, Voltaire und Montesquieu dachten es vor: Wo wirtschaftliche Freiheit herrscht, wird es an politischer Freiheit nicht fehlen können. Von der Freiheit des Handels zur Freiheit des Handelns ist es nur ein kleiner Schritt. Der Königsberger Philosoph Immanuel Kant schließlich schuf sogar eine strenge Einheit aus Gemüts- und Staatsverfassung: Die innere Freiheit des Menschen macht ihn fähig zur Vernunft. Die Vernunft macht ihn fähig zur Moral. Die Moral manifestiert sich im Recht. Und das Recht garantiert dem Bürger die äußere Freiheit. Die Gedankenfolge war so bestechend, dass sie noch heute Grundlage eines jeden europäischen Verfassungsentwurfs ist.
Die Geschichte der bürgerlichen Freiheit erschien lange als Erfolgsmodell. Spätestens nach dem Ende des Kalten Krieges wähnten sich die westlichen Demokratien endgültig als das beste Staats- und Wirtschaftssystem aller Zeiten. Der US-amerikanische Politologe Francis Fukuyama schritt 1990 durch das Regierungsviertel in Washington und erklärte vollmundig das "Ende der Geschichte". Die Idee dazu lieferte ihm ein deutscher Philosoph: Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Für Hegel war Geschichte ein endlicher Prozess. Träumte das Christentum vom Anbruch des göttlichen Zeitalters auf Erden, so verkündete Hegel einen Abschluss der Geschichte im optimalen Staat. Für Hegel war dieses Traumreich der preußische Beamtenstaat zu Anfang des 19. Jahrhunderts - die Verwirklichung des "Weltgeistes". Für Fukuyama war es der Sieg von Grundrechten, Rechtsstaat und freier Marktwirtschaft in der westlichen Welt.
Zwanzig Jahre nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus ist diese Selbstsicherheit des Westens dahin. Und mit ihr der Glaube, dass unsere Demokratie das Erfolgsmodell der Zukunft ist. Die größten Exportnationen der Welt können viel verkaufen - ihre Staatsform gehört nicht dazu. Heute müssen sie lernen, dass es auch ohne Demokratie geht. In den Golfstaaten zum Beispiel, in Russland und in China. Die heilige westliche Allianz aus Grundrechten, Rechtsstaat und Marktwirtschaft zählt dort nicht viel. Mag der Westen den Chinesen die Menschenrechte um die Ohren hauen - nicht mal in der Bevölkerung sind sie ein großes Thema. Wer mit Umweltverschmutzung, Wohnungsnot und Überbevölkerung zu kämpfen hat, hat andere Sorgen. Und Menschen, denen der Staat Wohlstand beschert, neigen selten zum Protest. Der "Weltgeist" des Philosophen Hegel ist launisch. Ein Zeitgeist, der mal in die eine Richtung schwebt und dann in eine andere.
Heiße und kalte Kriege
60 Jahre war sie ein Erfolgsmodell - die bundesdeutsche Demokratie. 150 Jahre währte der Prototyp - die Demokratie im alten Athen. Sie wurde groß in einer kollektiven Anstrengung aller gesellschaftlichen Kräfte gegen einen äußeren Feind: die Perser! Der heiße und der kalte Krieg gegen den Aggressor währte Jahrzehnte. Für Athen waren die Perser das Gespenst des Ostblocks späterer Tage. Zentralmacht statt Föderalismus, Armut statt Reichtum, Sklaverei statt Freiheit. Der Attische Seebund ist die Nato der hellenistischen Welt. Und dann, nach dem Sieg gegen den Osten - der GAU! Der Seebund zerfällt, Einzelegoismen beherrschen die Szene. Die Supermacht Athen überschuldet sich in sinnlosen Feldzügen und Expansionskriegen. Der Krieg im fernen Sizilien ruiniert die Staatskasse und gerät zum Fiasko. Eine neue Supermacht tritt auf den Plan, undemokratisch, brutal, neureich: Den Spartanern haben die Athener nichts mehr entgegenzusetzen. Zuletzt kommen die Makedonen aus dem Norden und löschen das Licht aus.
Zeitzeugen dieses Verfalls sind Dichter und Philosophen. Aischylos, Sophokles. Euripides und Aristophanes, Platon und Aristoteles, Zenon und Epikur können sagen, sie waren dabei. Nie zuvor erlebte das Abendland eine solche Blüte der Kunst und einen solchen Sturm bahnbrechender Ideen wie in den Zeiten des Niedergangs von Athen. Die Orientierungskrise sollte dem Stadtstaat nicht viel nützen. Die Ideen jedoch wirken bis heute.
Die Parallele ist unverkennbar. Das Erstarken der Konkurrenz, die militärische Überanstrengung der USA, die Überschuldung. Die westliche Geldwertegemeinschaft zweifelt an ihrem Fortbestand. Wo ist das Band, das unsere Werte noch zusammenhält, die Moral, die uns eint? Der Selbstbedienungsladen für die Zutaten unseres Lebens ist unüberschaubar geworden. Die Unterhaltungselektronik amüsiert uns bis zur Vollverblödung. Und der Preis sind schmelzende Polkappen, vergiftete Meere, geplünderte Ressourcen und Klimawandel in aller Welt.
Sternstunden in der Krise
Philosophie blüht in der Krise. Unsere Weltlage heute erinnert sehr an ihre beiden größten Sternstunden: an den Untergang Athens und an die Zeit der Aufklärung. Schwere Zeiten, Orientierungskrisen und erschütternde Umbrüche beflügeln philosophische Gedanken. Der erste Umbruch zerstörte die Demokratie und ermöglichte langfristig den Aufstieg einer totalitären Ideologie: des mittelalterlichen Christentums. Der zweite Umbruch brachte die Errungenschaften der Gewaltenteilung, des Rechtsstaates und der Parlamente. Wohin wird uns der Umbruch der heutigen Zeit führen?
Unser Leben hat eine Komplexität erreicht wie nie zuvor in der Geschichte. Und unsere Steinzeitgehirne verlieren die Orientierung. Dabei lernen wir diese Gehirne heute gerade erst kennen. Als meine Großeltern geboren wurden, passte das gesicherte Wissen über das menschliche Gehirn noch auf eine DIN-A4-Seite. Als mein Vater Abitur machte, erforschte man gerade das grundsätzliche Zusammenspiel zwischen Elektrik und Chemie. Heute arbeiten Tausende Hirnforscher in aller Welt an der Entschlüsselung des Gehirns. Ihr Projekt ist die Suche nach dem Mechanismus, der Geist erzeugt. Und sie studieren unsere Gefühle. Sie legen Mönche in Kernspintomografen und entdecken religiöse Zentren im Gehirn; sie benennen die Kerne im Hypothalamus, die die weibliche von der männlichen Lust unterscheiden. Und sie haben jene Nervenzellen entdeckt, die uns mit anderen Menschen mitfühlen lassen.
Welche Orientierung können uns die Hirnforscher geben? Was können wir von ihnen über uns selbst lernen? Etwas Bestürzendes, wie es zunächst scheint. Der Homo sapiens der Hirnforscher ist nämlich weder weise noch einsichtig. Er ist triebgesteuert und automatisiert in vielen seiner Reaktionen. Sein Motor ist das Unbewusste im Zwischenhirn, nicht das Bewusstsein im Großhirn. Haben die Hirnforscher recht, so ist unsere Vernunft nicht die Schaltzentrale unseres Handelns. Vielmehr ist sie eine Werbeabteilung mit nachfolgenden Rechtfertigungen. Wir fahren in einem Auto, das zu viel CO2 ausstößt, zu einer Geliebten, haben Sex mit ihr ohne Kondom und zünden uns nachher eine Zigarette an. Eigentlich finden wir nichts davon in Ordnung. Wir sind gegen Umweltverschmutzung, gegen Betrug in der Ehe, gegen den fahrlässigen Umgang mit dem Aids-Risiko und wissen, dass Zigaretten schädlich sind. Nach vollzogener Tat allerdings sehen wir die Dinge gelassener. Man muss ja nicht unbedingt der beste Mensch sein wollen. Und mit dem Rauchen könnte man sicher aufhören, wenn man nur wollte.
Die Hirnforschung setzt Impulse
Natürlich übertreiben die Hirnforscher ein wenig, wenn sie meinen, dass der Mensch überhaupt keine Freiheit des Willens hat, nur weil sie diese Freiheit mit ihren Mitteln nicht zeigen und verstehen können. Und sie übertreiben maßlos, wenn ihre populären Buchtitel verkünden, die Rätsel des Bewusstseins, des Denkens oder der Intelligenz wären heute gelöst. Der Impuls aber, den sie geben, ist beträchtlich und in den Fakultäten der deutschen Hochschulphilosophie noch immer stark unterschätzt. Umso erfolgreicher sind sie im Buchhandel. Mehr als 100.000 Bücher über das Gehirn wandern Jahr um Jahr über deutsche Ladentische.
Die Neurobiologie, so scheint es, ist die Philosophie unserer Zeit. Sie verspricht Fakten, wo die Philosophen nur spekulieren können. Doch was sagt sie uns in der Frage, wie wir leben sollen? Was verrät sie uns über unsere Zukunft? Was weiß sie über die Globalisierung, über Arm und Reich, Krieg, Klimawandel, Migration und Demokratie?
Wenig, sollte man meinen. Doch biologische Theorien mit Ausflügen in die vermeintliche Architektur unseres Gehirns haben Konjunktur. Gene, Neurone und Evolutionsgesetze sind der Stoff, aus dem die Welterklärungsmodelle sind. Die sogenannte Evolutionäre Psychologie ist die Boomdisziplin unserer Zeit. Und keine Aufgabe scheint ihr zu schwer. Sie erklärt uns, warum es keinen Gott gibt, warum Staaten untergehen und Frauen nicht einparken können. Hinter all dem steht ein alter Traum: die Suche nach Naturgesetzen, die das verrückte Handeln der Menschen logisch erklären. Für die Evolutionären Psychologen nämlich ist der Mensch von Natur aus extrem festgelegt, vorherbestimmt durch Gene, Triebe, Gehirnschaltkreise und evolutionäre Strategien.
Der Mensch als Sklave der Natur
Die Situation heute könnte paradoxer kaum sein. Während unsere äußere Freiheit alle Grenzen sprengt, beschränken die Biologen unsere innere Freiheit auf ein Minimum. Für die Philosophen der Aufklärung war der Mensch innerlich frei. Nur die äußeren Umstände engten ihn ein. Noch Jean-Paul Sartre, der bedeutendste Verfechter der menschlichen Freiheit im 20. Jahrhundert, hatte den Menschen zum Souverän seiner selbst erklärt. Der Mensch, so Sartre, schaffe sich selbst wie ein Künstler sein Kunstwerk. Auf unser Tun kommt es an. Alles ist möglich - yes, we can! Für die Biophilosophen der Gegenwart dagegen ist der Mensch ein Sklave seiner biologischen Natur. Ihre Prognosen sind düster - no, we cannot!
Welchen Deutungen kann man trauen? Welches Menschenbild ist verlässlich? Welche Gesellschaft ist denkbar und welche nicht? Hunderttausende Deutsche sehnen sich nach einer Orientierungswissenschaft, die diesen Namen verdient. Die Zahl der Menschen, die sich von einfachen biologischen Wahrheiten oder von Esoterik beeindrucken lässt, schwindet. Die fernöstlichen Lebensweisheiten für den Seelenfrieden sind auf dem Rückzug. Und Reichtum als Lebensglück passte zwar zur Generation Golf, nicht aber zur Bankenkrise. Dass Geld glücklich macht, stimmt - allerdings nur so lange, bis die Grundbedürfnisse befriedigt sind. Von da an steigt das Glück nicht mehr proportional zum Einkommen. Die Ackermänner der Republik sind nicht ihre glücklichsten Menschen.
Orientierung heißt das Zauberwort, nicht Werte. An denen nämlich besteht kein Mangel. Die meisten Menschen in Deutschland sind für Freiheit und Sicherheit, Basisdemokratie und Führungsstärke, Wirtschaftswachstum und ökologische Nachhaltigkeit, billiges Öl und gesunde Luft, Internet und Jugendschutz, Hochglanzverpackungen und Müllvermeidung. Wir haben nicht zu wenige Werte, wir haben zu viele, die einander widersprechen.
Die Prophezeiung von Marx
Die Vorratskammern der Philosophie enthalten vieles, über das man heute neu nachdenken kann. Der Philosoph Epikur von Samos versammelte in seinem Garten die Athener Jugend und brachte ihr bei, Körper und Seele im Gleichgewicht zu halten, das Wohl des einen nicht ohne das des anderen zu sehen. Er brachte ihnen bei, andere Werte zu finden als Reichtum und Macht. Der jüdische Philosoph Baruch Spinoza erkannte das physiologische und psychische Wechselspiel von Körper und Geist, das viele Hirnforscher für ihre eigene Erkenntnis halten. Und ein gewisser Karl Marx enträtselte in drei wuchtigen Bänden die Gesetze des Kapitals und auch seine Selbstzerstörungskraft. Noch vor jeder proletarischen Revolte sollte das "fiktive Kapital" der internationalen Finanzwelt die Volkswirtschaften zersetzen und den Kapitalismus in den Abgrund reißen. Der offene Kapitalmarkt und seine Feinde - im dritten Band des Kapitals finden wir die Prophezeiung.
Als die Demokratie im alten Athen Schiffbruch erlitt, waren Philosophen ihre Zuschauer. Sie diskutieren auf der Agora, dem Marktplatz, und auf dem Pnyx-Hügel, dem Ort der Bürgerversammlung. Heute suchen Millionen Menschen in Deutschland nach Orientierung. Sie machen sich Gedanken um unsere Zukunft und um die Zukunft unserer Kinder. Ob uns die großen Umbrüche unserer Zeit in den Untergang führen oder in eine bessere Zeit, ist noch nicht ausgemacht. Wir aber sind keine Zuschauer. Wir sind mittendrin.