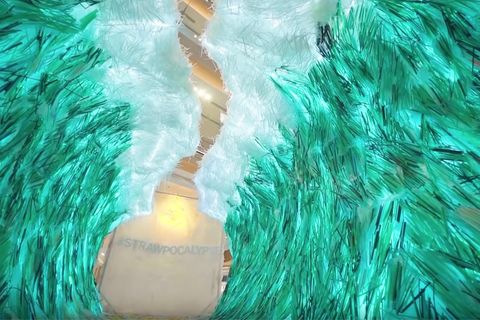"Eine einzige riesige Wasserwand." Ronald Warwick, heute Kapitän der "Queen Mary 2", traf im Februar 1995 mit seinem Kreuzfahrtschiff "Queen Elizabeth 2" im Nordatlantik auf eine der so genannten Monsterwellen, die sich Augenzeugenberichten zufolge bis zu 35 Meter hoch auftürmen können. Mehr als 200 Großschiffe gingen in den letzten 20 Jahren auf den Weltmeeren unter - die meisten dürften Opfer solcher "Freak Waves" geworden sein, sagt Wolfgang Rosenthal vom GKSS Forschungszentrum in Geesthacht bei Hamburg.
Kein Seemannsgarn
Rosenthal leitete ein EU-Projekt zu dem Phänomen, das noch vor zwei Jahrzehnten meist als Seemannsgarn abgetan wurde. Die Auswertung von Radardaten, die von Satelliten der Europäischen Weltraumagentur ESA in Paris stammen, brachte eine beunruhigende Erkenntnis: Monsterwellen gibt es offenbar sehr viel häufiger als bislang angenommen. In einem Zeitraum von nur drei Wochen im Frühjahr 2001 erfassten die Satelliten nicht weniger als zehn Wellen von mehr als 25 Metern Höhe. "Die Häufigkeit hat auch uns überrascht", sagt Rosenthal.
Damals wurden im Südatlantik binnen einer Woche gleich zwei Kreuzfahrtschiffe fast Opfer von Monsterwellen. Diese zerschlugen nach Darstellung der ESA bei der deutschen "Bremen" und der britischen "Caledonian Star" die Fenster der Kommandobrücken, die 30 Meter über der Meeresoberfläche lagen. Die "Bremen" trieb zwei Stunden antriebslos und ohne Navigationssysteme auf offener See. Auch den Untergang der "München" bei den Azoren im Jahr 1978, des damals modernsten Containerschiffes der Hapag-Lloyd, schreibt Rosenthal Riesenwellen zu.
Hinweise schon in Homers Odyssee
Hinweise auf diese Ungetüme fänden sich schon in Homers Odyssee, sagt der Meeresforscher. Doch erst in jüngster Zeit wurde ihre Existenz wissenschaftlich nachgewiesen. Ein Laser auf der Nordsee-Bohrinsel Draupner, der die Entfernung zur Wasseroberfläche misst, zeichnete am 1. Januar 1995 eine 26 Meter hohe Welle auf. Die Auswertung der ESA-Radardaten habe sogar "Freak Waves" von bis zu 30 Metern nachgewiesen. Augenzeugen sprächen von bis 35 Metern. "Noch vor 20 Jahren hätte ich gesagt: Das kann nicht stimmen. Aber heute glaube ich ihm das", sagt Rosenthal zu dem Bericht des erfahrenen Kapitäns Warwick.
Inzwischen gibt es erste Erklärungen für die Entstehung von "abnormalen individuellen Wellen", wie die Forscher sie nennen. Sie bilden sich besonders häufig dort, wo Wellen auf Meeresströmungen und Wasserwirbel treffen. "Strömungen sind an den Rändern weniger schnell als in der Mitte, die Welle wird dann wie in einer Lupe fokussiert", erklärt der GSKK-Wissenschaftler. Solche Phänomene könnten am Golfstrom im Nordatlantik auftreten oder am Agulhasstrom vor Südafrika, "auch bei relativ gutem Wetter".
Keine Verbindung zu Tsunamis
Gefährlich wird es immer dann, wenn ein lang anhaltender Sturm und eine Welle zusammentreffen, die sich zufälligerweise synchron zur Windgeschwindigkeit bewegt. Dann kann sich die Welle immer weiter hochschaukeln. "Freak Waves" haben übrigens nichts mit den so genannten Tsunamis zu tun, die durch Meeresbeben entstehen. Eine Vorhersage dieser Launen der Natur und damit die Möglichkeit, die Schifffahrt zu warnen, steckt noch in den Kinderschuhen. "Wir versuchen, die Wellen mit Radar zu erfassen und ihren Verlauf zu prognostizieren", erklärt Rosenthal. "Aber das ist bislang noch graue Theorie."
Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Erwärmung der Weltmeere durch den Treibhauseffekt und der Häufigkeit dieser extremen Wellen? "Das wäre möglich", meint der Forscher. Er hat nun noch mehr Radardaten von der ESA erbeten, um die Entwicklung über einen längeren Zeitraum untersuchen zu können.
Doch schon heute müssten Schiffbauer umdenken. So sollte die Brücke - und befinde sie sich auch 30 Meter über dem Meeresspiegel - so konzipiert werden, dass ihre Fenster nicht gerade als Wellenbrecher dienten. Die Luken müssten so stark ausgelegt sein, damit sie von den "Freak Waves" nicht zerschlagen werden und das Schiff volllaufen und sinken kann.
Uwe Gepp, AP