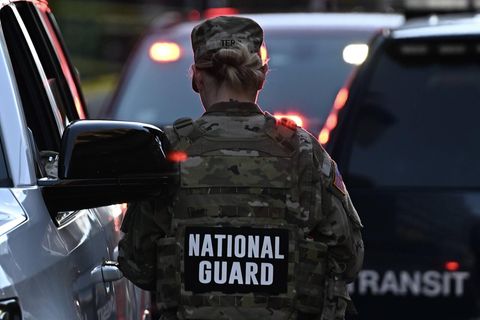Die Geberländer der Afghanistan-Konferenz loben einmal mehr Hamid Karsai und damit sich selbst. Afghanistans Präsident darf sich in London über Finanzzusagen von 8,7 Milliarden Euro freuen. Herr über das Geld bleibt allerdings der Westen. Der Wunsch der afghanischen Regierung, über die Hälfte der Mittel künftig selber zu entscheiden, wurde nicht ernsthaft verhandelt. Afghanistan bleibt weiterhin am Tropf der internationalen Staatengemeinschaft.
Es sind ehrgeizige Ziele
, auf die man sich in London für die nächsten fünf Jahr gesteckt hat: Strom für jeden vierten Afghanen auf dem Land, jährlich sollen drei Prozent mehr Menschen mindestens einen Dollar am Tag verdienen. Ernsthaft einklagen kann diese Ziele keiner, dafür stehen statistische Erhebungen in Afghanistan bis auf weiteres auf zu wackeligem Fuß.
Der Aufbau einer schlagkräftigen Armee mit bis zu 70.000 Mann verweist auf das schwierige Verhältnis von Sicherheit und Drogenbekämpfung. In diesem Punkt - dem vermutlich wichtigsten - einigte man sich in London auf gut klingende Absichtserklärungen: Die afghanische Regierung soll den Mohnanbau weiter reduzieren und mehr Dealer und korrupte Beamte verhaften. Gut gebrüllt! Denn der Westen selbst sendet nur schwache und widersprüchliche Signale. Amerikaner und Engländer streiten darüber, ob und wie Opiumfelder aus der Luft vernichtet werden können. Das EU-Parlament hingegen hat kürzlich eine Resolution verabschiedet, in der von der Legalisierung des Opium-Anbaus zu medizinischen Zwecken die Rede ist. Niemand aber wagt sich an die verantwortlichen Drogenbarone, weder Karsai noch die internationale Staatengemeinschaft.
Solange jedoch das Drogengeschäft boomt
, kommt die reguläre Wirtschaft nicht vom Fleck. Auch nach vier Jahren Wiederaufbau hat Afghanistan kaum verarbeitende Industrie. Komplexe Produkte müssen importiert werden, die Globalisierung ist eine Einbahnstraße, die in Kabuler Supermärkten endet. Das Land hat nicht einmal genügend Mittel, um die eigenen Rohstoffe auszubeuten. Aber in London hieß es nur vage, die private Wirtschaft solle gestärkt werden.
Bloß wie? Vertreter der Weltbank hatten vor der Konferenz von einem "Skandal" gesprochen und Zahlen vorgelegt, wonach ein Großteil der Hilfsgelder bislang in schlecht durchdachten Projekten versickert ist. Zum Beispiel baute die amerikanische Louis Berger Group 550 Schulen für 225.000 Dollar pro Einheit. Eigentlich wären 50.000 Dollar pro Schule ausreichend gewesen. Vergeudete Summe: 96 Millionen Mark. Das Geld ist vermutlich in private Taschen geflossen - die Korruption ist sowohl auf afghanischer wie auf ausländischer Seite verbreitet. Viele Organisationen haben, obwohl sie Millionen verwalten, jahrelang nicht nachweisen müssen, wo und wie sie ihr Geld ausgeben. Dass Karsais Regierung nun ein gewisses Mitspracherecht fordert, ist verständlich. Aber in London hieß es, die afghanische Verwaltung sei noch nicht so weit beziehungsweise selbst korrupt. Vertrauen sieht anders aus.
Bei den Menschenrechten verengt sich der westliche Blick
auf die Rechte von Frauen. Außerdem wird permanent eine mögliche Rückkehr der Taliban beschworen. Der Kampf um Presse- und Meinungsfreiheit hingegen wird kaum beachtet, obwohl er nicht weniger wichtig ist. Hilfsgelder für solche Projekte werden zurückgefahren. Auch in der Justiz liegt vieles im Argen. Afghanische Menschenrechtler fordern, gegen die vielen Rechtsbrecher vorzugehen, die jetzt im Parlament sitzen - entweder mit Gerichtsverfahren oder einer Wahrheitskommission nach südafrikanischem Vorbild. Aber solange nicht einmal Ansätze einer unabhängigen Justiz absehbar sind, bleibt das ein Wunschtraum.
Schließlich die militärische Bedrohung: Die steigende Zahl von Selbstmordanschlägen, unter anderem gegen ISAF-Truppen, wirft die Frage auf, ob in Afghanistan bald irakische Verhältnisse herrschen. Doch der Vergleich hinkt. In Afghanistan gibt es keine Entführungsindustrie und die Bevölkerung steht mehrheitlich hinter den internationalen Truppen. Hilfreich wäre, wenn die Nato auch jenseits von Kabul, also im Süden des Landes für mehr Sicherheit sorgen könnte - dann wären dort mehr Hilfsprojekte möglich. Gleichwohl wäre auch denkbar, mit weniger Militär auszukommen. Der größte Teil der Mittel wird für die Sicherheit der Soldaten ausgegeben und nicht für die Sicherheit der afghanischen Bevölkerung. Würde man dieses Geld in zivile Projekte stecken, wäre der Aufbau effektiver.
Last not least wäre Afghanistan geholfen, wenn sich die
Medien
um ein abgewogeneres Bild des Landes bemühen würden. Räumen wir mit ein paar klassischen Missverständnissen auf: Die Burka ist nicht nur ein Symbol der Unterdrückung, sie kann Frauen - unter den herrschenden Umständen - auch schützen. Die Zerstörung von Kabul geht nicht auf die Taliban zurück, sondern auf den Bürgerkrieg zwischen den Jahren 1992 und 1996. Und: Solange wir nur Afghanistan-Images produzieren, die von Leiden und Sterben beherrscht sind, werden wir die Afghanen nicht als ebenbürtig betrachten. Solche Berichterstattung verhindert nur, den Menschen wirklich zuzuhören.
Martin Gerner, 39, ist freier Journalist und auf Afghanistan spezialisiert