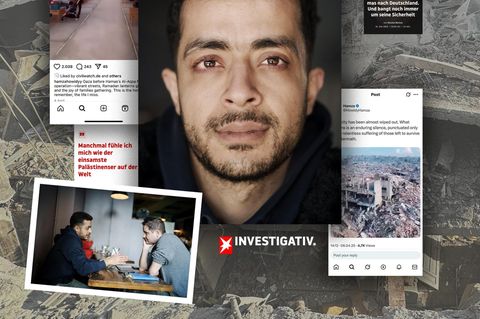Mohammed war eher klein für sein Alter. Rundes Kindergesicht mit Brille, Typ Musterschüler - so zeigen den Zwölfjährigen die Plakate, die jetzt überall an den zerschossenen Hauswänden des Flüchtlingslagers Khan Yunis im Gaza-Streifen kleben. Ein israelischer Wachposten hat das Kind erschossen, weil er, so die offizielle Verlautbarung, das Plastikgewehr in Mohammeds Hand für eine echte Waffe gehalten habe.
»Mohammed saß hier mit seinem Cousin auf der Schwelle«, sagt seine Tante und zeigt auf die Straßenecke, »plötzlich krachten zwei Schüsse. Einer traf ihn, hier oben.« Sie deutet auf die linke Brustseite knapp über dem Herzen. Sie sei auf ihn zugeeilt. »Halt mich« stöhnte der Junge, »mich hat es erwischt.« Krämpfe schüttelten den kleinen Körper, dann erschlaffte er. »Warum haben sie ihn umgelegt?«, fragt wütend ein Mann, der zu uns stößt, »drei Tage war hier kein Schuss mehr gefallen, und dann knallen sie einfach los, auf Kinder.« Er spuckt auf den aufgeweichten Lehmboden.
Tiefe Spuren in den Kinderseelen
Alle Jungs hier spielen mit Plastikgewehren. Der Bürgerkrieg in Palästina hinterlässt tiefe Spuren auch in den Kinderseelen. Dass die israelischen Soldaten Mohammed und sein Spielzeuggewehr als Bedrohung ansahen, klingt lächerlich. Der Wachturm, von dem aus sie ihn ins Visier nahmen, nachmittags gegen halb vier bei vollem Büchsenlicht, ist gut 100 Meter entfernt. Eine Festung auf Stelzen. Gepanzert, mit Sandsäcken ausgekleidet. Die Gesichter der Soldaten sind hinter den Sehschlitzen und Schießscharten nicht auszumachen: Selbst wenn die Waffe in den Händen des Jungen eine echte Kalaschnikow gewesen wäre, hätte er gegen dieses Bollwerk nichts ausrichten können.
Auf wen schießen die Israelis in Khan Yunis? Natürlich nur auf palästinensische Terroristen. So wie Mohammed. Oder wie der Fünfzehnjährige, den sein Vater in der Abenddämmerung noch einmal losschickte, die Tür des Hauses zuzusperren, aus dem die Familie geflüchtet war? Der Junge hatte Pech. Ausgerechnet auf diese Tür hatten die israelischen Scharfschützen freies Schussfeld. Eine Kugel traf ihn in den Kopf. Er liegt im Hospital von Gaza. »Keine Gehirnströme mehr«, sagt seine Großmutter. Er ist eine lebende Leiche.
Allah sei Dank
Oder auf Kleinkinder, wie den Jungen im Strampelanzug, den uns eine Mutter anklagend entgegenstreckt? Der Schuss peitschte schräg von oben durch das Eternitdach und streifte den Kopf des Babys. Die Wunde verheile gut, sagt die Mutter, Allah sei Dank. Allerdings wache ihr Söhnchen jetzt jede Nacht weinend auf.
Und warum hat sich die israelische Armee hier in Khan Yunis überhaupt eingebunkert? Schließlich liegt das Camp mit seinen rund 70 000 Bewohnern nicht an der Grenze zu Israel, das mit Recht Selbstmordkommandos und Terrorattacken auf sein Staatsgebiet fürchtet, sondern mitten im Gaza-Streifen, der ja angeblich unter autonomer palästinensischer Verwaltung steht. Die Antwort ist so einfach wie absurd. Die Armee schützt jüdische Siedler.
Wie ein Pfahl im Fleische Gazas erhebt sich das Settlement Neve Dekalim hinter dem Flüchtlingslager. Eine Festung, umgeben von einem Betonwall, höher als die Berliner Mauer - und bemerkenswert unversehrt. Von den Feuerüberfällen der
Palästinenser, auf die Israels Armee angeblich nur reagiert, sind keine Spuren zu sehen. Auf den Wachtürmen flattert die israelische Fahne mit dem Davidstern. Eine ausgeklügelte Bunkeranlage mit Betonunterständen, Erdwällen und Tarnnetzen schützt die Zufahrtsstraße. Panzer für die spezielle Kriegsführung hier in Gaza stehen bereit. Zum einen sind es Räum-Panzer, die bei Bedarf durch die Behelfsbauten von Khan Yunis pflügen wie durch Krüppelwald. Zum anderen Kampf-Panzer mit vier Maschinengewehren, die gleichzeitig in alle Richtungen schießen können, ohne dass der Panzer auch nur den Turm zu drehen braucht. Neben ihnen ist der »fahrende Mast« geparkt, eine etwa 30 Meter hochragende Hebebühne auf Rädern, natürlich gepanzert. Überall einsetzbar, sodass Schützen aus luftiger Höhe das Feuer eröffnen können - mit bestem Sicht- und Schusswinkel.
»Hier ist und bleibt Israel«
Die jüdische Siedlung hinter dem waffenstarrenden Schutzwall ist ein schmuckes Gemeinwesen. Ein adrettes Wachhäuschen am Eingang. Palmen, durch die der Wind vom nahen Meer her leise fächelt. Weite Rasenflächen, die gut gewässert werden. Das Gemeindezentrum mit Restaurant, Bethaus und Versammlungsraum ist der Stolz des Ortes. Ein Architekt mit Sinn für Symbolik hat die Fassade in Form eines Davidsterns gestaltet: Hier ist und bleibt Israel.
»Und so sieht es bei uns aus«, sagt bitter der Journalist Hazim. Sein Finger deutet auf die Ruinenlandschaft auf palästinensischer Seite. Durchlöcherte Fassaden, plattgewalzte Häuser, Gebäude, von denen nur noch die halb zerborstenen Außenmauern stehen. »Aber die Amerikaner sagen, wir müssten zuerst mit der Gewalt Schluss machen.«
Aus dem Trümmerfeld sprießen weiße Pilze, Zelte, in denen Menschen leben, deren Häuser von den Israelis zerstört wurden. Sie alle erzählen die gleiche Geschichte in immer neuen Variationen. Wie nachts die Panzer anrollten, Häuser niederwalzten und wie sie mit Kind und Kegel zu Verwandten in den sicheren Zonen von Khan Yunis flüchteten. Wie Geschosse die Wände
und Dächer durchschlugen, so zufällig und unberechenbar, dass sie in ständiger Angst leben. Während wir die Obdachlosen besuchen, peitschen zweimal Gewehrschüsse ohne ersichtlichen Grund über das Areal. Alles duckt sich kurz. Dann ist wieder Ruhe.
»Ich traute mich im Dunkeln nicht mehr aufs Klo, weil die Tür zur Toilette immer wieder unter Feuer geriet«, sagt ein wütender alter Mann. Er habe schließlich in eine Plastikkanne gepinkelt, die er hinter einer dicken Mauer platzierte. Eine ältere Dame schlägt die Eingangsplane zu ihrem Zelt zurück. Auf einer Decke liegt teilnahmslos ihr schwerbehinderter Sohn. »Als die Israelis unser Haus zerstörten, haben sie auch seinen Rollstuhl platt gewalzt«, so die Frau, »jetzt kann ich ihn überhaupt nicht mehr fortbewegen.«
Hochburg von Hamas und Islamischem Dschihad
Ganz ohne Zweifel ist Khan Yunis eine Hochburg von Hamas und Islamischem Dschihad, den beiden militanten Fundamentalistengruppen, die durch Waffengewalt und Selbstmordbomber die Israelis aus Palästina vertreiben wollen. Die Hauswände sind voll mit Graffiti, auf denen Handgranaten explodieren oder Busse in die Luft fliegen, und unter die Plakate der Märtyrer mischen sich immer wieder Bilder Osama bin Ladens. Mit ein paar Hetzparolen gegen die Besatzer lässt sich hier leicht Nachwuchs für den »heiligen Kampf« rekrutieren.
Doch ganz ohne Zweifel tragen auch die Israelis ihren Teil dazu bei, die Menschen im Gaza-Streifen in die Arme der Radikalen zu treiben, wenn sie unter dem Vorwand, den Terrorismus zu bekämpfen, so wahllos und überzogen vorgehen wie in diesen Tagen. »Es sind nicht nur die so genannten Vergeltungsschläge, die unsere Leute wütend machen«, sagt Dr. Mohammed Shamlay, »fast genauso schlimm ist die tägliche Demütigung, mit der wir hier in unserem eigenen Land leben müssen.«
»Man konnte die Körperteile nicht mehr zuordnen«
Der Arzt praktiziert in der Naser-Klinik, die nur 200 Meter von den zerstörten Häuserzeilen entfernt liegt. Im Schnitt, sagt er, behandele er pro Tag 20 Verletzte mit Schuss- oder Splitterwunden. Der schlimmste Anblick seiner Chirurgenkarriere seien die Überreste der fünf Kinder gewesen, die von einer nachträglich explodierten israelischen Panzergranate Ende November in Fetzen gerissen wurden: »Man konnte die Körperteile nicht einmal mehr den einzelnen Individuen zuordnen.«
Tag für Tag müsse er mit ansehen, wie seine Patienten mit komplizierteren Schuss- oder Brandverletzungen es nicht wagten, sich nach der Erstversorgung in der Naser-Klinik zur Spezialbehandlung ins zentrale Hospital von Gaza-Stadt überführen zu lassen: »Sie haben Angst, an den Straßensperren als mutmaßliche Terroristen festgenommen zu werden.« Krebskranke schafften es wegen der vielen Kontrollpunkte häufig nicht, rechtzeitig zu ihrer Chemotherapie zu kommen. Seit September 2000 sind sieben Fälle bekannt geworden, in denen palästinensische Mütter ihre Kinder an Kontrollposten geboren haben, wo sie auf dem Weg ins Hospital aufgehalten wurden.
Obwohl auf dem Papier autonom, ist der Gaza-Streifen in der Realität noch immer eine israelische Kolonie mit einer
Zweiklassenstruktur: oben die 6000 israelischen Siedler, unten die über eine Million Palästinenser. Autobahnähnliche Straßen verbinden die neuen jüdischen Dörfer. Sie sind strikt für den Verkehr der Siedler reserviert. An manchen Stellen errichten die Israelis aufwendige Brückenkonstruktionen, um quer laufende Palästinenser-Sträßchen kreuzungsfrei zu überqueren. Die sind meist vielfach geflickt und kurvig. Was passieren würde, falls er sich auf die Siedler-Autobahn verirre? »Bumm, bumm«, sagt schief grinsend der Taxifahrer, der uns durch Mawassi chauffiert.
Absurdes Beispiel der Realität
Dieses Dorf ein paar Kilometer außerhalb von Khan Yunis ist ein ganz besonders absurdes Beispiel der Realität in Gaza. Denn es ist eingezwängt zwischen zwei jüdische Siedlungen und daher für normale Palästinenser Sperrgebiet. Lediglich Einwohner von Mawassi mit Sonderausweis dürfen den Checkpoint passieren. Nur zu Fuß allerdings. Für Autos ist die Straße mit Betonblöcken gesperrt. In gebührendem Abstand vom israelischen Checkpoint haben die Leute zu verharren, bis eine Lautsprecherstimme sie aufruft, vorzutreten und beim schwerbewaffneten israelischen Posten hinter Panzerglas die Kontrollformalitäten zu erfüllen.
Wenn die Bauern von Mawassi ihre Tomaten oder Gurken auf die Märkte von Gaza schaffen wollen, fährt ein Lkw mit den Gemüsekisten rückwärts bis hart an die Betonsperre des israelischen Kontrollpostens heran. Dann wird die Fracht per Hand auf einen Laster von drüben umgeladen. Während die Kisten umgestapelt werden, sitzt ein palästinensischer Junge im Führerhaus des Lkw aus Mawassi. »Eine Vorsichtsmaßnahme«, vertraut uns der israelische Wachposten an, »damit wir sicher sind, dass die Ladung wirklich Gemüse und nicht Sprengstoff ist.«
»Mit unseren Kalaschnikows gegen deren Feuer-Power?«
300 Meter vom Checkpoint entfernt liegt außer Sicht der Israelis die Station der palästinensischen Polizei. Sie ist ein armseliges Zelt mit Durchschüssen, in dem sich zwei Uniformierte bei einer Tasse Tee aufwärmen. Wenn es zu krachen beginne, sagt der ältere der beiden Polizisten, würden sie schnell ihren Posten verlassen und hinter massiven Häusern in Deckung gehen. Auch ohne das Zelt zu sehen, wüssten die Israelis nämlich genau, wo es stehe. Ob sie, die Polizisten Arafats, zurückschießen? »Mit unseren Kalaschnikows gegen deren Feuer-Power?«, fragt der Mann, »was können wir da schon ausrichten?«
Feiglinge seien die Juden, einfach Feiglinge, meint sein junger Kollege hitzig. 82 Menschen hätten sie seit Beginn der Intifada vor 15 Monaten allein hier in Khan Yunis umgebracht, aus ihren bombensicheren Stellungen heraus, die meisten davon Frauen, Kinder, alte Männer.
»Sind Selbstmordattentate, bei denen auch meistens Unschuldige getötet werden, die richtige Antwort darauf? Oder heizen sie das tödliche Klima von Gewalt und Gegengewalt nur noch weiter an?« Die beiden drucksen herum. »Was wollt ihr Europäer eigentlich«, ruft ein junger Mann vom Zelteingang aus dazwischen, »seht ihr nicht, dass die Märtyrer mit dem Sprengstoff auf dem Leib unsere einzige Waffe sind? Wir brauchen nicht einen Selbstmordattentäter in Tel Aviv oder Jerusalem, wir brauchen tausend.« Unsinn, sagt leicht verlegen der ältere Polizist, sie versuchten ja, ihre jungen Leute zurückzuhalten, doch so einfach sei das nicht. Immerhin handele es sich ja um palästinensische Brüder.
Am Ende sind fünf Palästinenser tot
In derselben Nacht halten Kollegen von ihm in Dschabaliya, einem anderen Flüchtlingscamp bei Khan Yunis, einen 17-jährigen Kämpfer des Islamischen Dschihads mit Waffengewalt zurück. Sie erschießen ihn, als er versucht, einen selbst gebastelten Granatwerfer gegen eine israelische Siedlung in Stellung zu bringen. Am Morgen darauf passiert der Begräbniszug mit der in eine palästinensische Flagge eingehüllten Leiche die örtliche Polizeistation, von der überlebensgroß ein Jassir Arafat in Öl auf sein Volk herniederschaut. Vermummte Dschihadkämpfer mit Sturmgewehren fangen an, wütend in seine Richtung zu ballern, die Polizei schießt zurück. Am Ende sind fünf Palästinenser tot. Fast zur selben Stunde bezichtigt die israelische Regierung Arafat zum soundsovielten Mal, gegen Terroristen in den eigenen Reihen nicht energisch genug vorzugehen.
Teja Fiedler