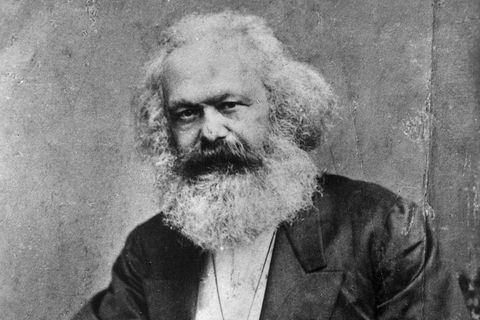Kubaner sind gelassene Menschen. Für sie ist der 24. Februar ein Tag wie jeder andere. Auch wenn der sieche Fidel Castro nun endgültig loslässt und sich vom Parlament nicht mehr zum Staatsratsvorsitzenden wählen lässt. Vor allem Ausländer spekulieren nun, was das für die Zukunft der Insel bedeuten könnte. Die Kubaner wundern sich über so viel Kaffeesatz-Leserei und sagen: Alles geht seinen sozialistischen Gang. Ob mit oder ohne Fidel Castro. Der Alte ist ohnehin schon lange verschwunden - und ist trotzdem, wie ein Zombie, noch immer präsent.
Seit er sich vor zwanzig Monaten zu einer Notoperation am Darm verabschiedete, haben gemeine Kubaner ihren Staats- und Parteichef nicht mehr leibhaftig gesehen. Im Fernsehen gab es einmal einen Videoclip, in dem er als zittriger Greis über einen Krankenhausgang stakste. Die Zeitungen - allesamt staatlich kontrolliert - druckten immer wieder Fotos, auf denen er über der Pyjama-Jacke den immer gleichen roten Adidas-Kittel trug. Und es erschienen an die 70 von ihm gezeichnete Kolumnen, in denen er sich mehr mit dem Erzfeind USA und dem Rest der Welt denn mit den Missständen auf der von ihm beherrschten Insel auseinandersetzt. Einen handfesten Beweis aber, dass er noch unter uns ist, den blieb Fidel Castro bislang schuldig. Und niemand erwartet, dass er ihn am Sonntag erbringen und seinen Platz im Parlament einnehmen wird.
Ich wiederhole: weder anstreben noch akzeptieren
Auf der Internetseite der Parteizeitung "Granma" schreibt er: "Hiermit teile ich mit, dass ich die Ämter des Staatsratsvorsitzenden und des Oberkommandierenden weder anstrebe noch akzeptieren werde, ich wiederhole anstreben noch akzeptieren werde". Sollte ihn das Parlament trotzdem noch einmal ins höchste Staatsamt wählen. Kuba würde sich dann langsam Nordkorea nähern, wo der Staatsgründer Kim Il Sung - obwohl seit 14 Jahren tot - noch immer als "ewiger Präsident" das höchste Amt im Staat bekleidet.
Castro ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit lebendig. Glaubwürdige Menschen wie der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva haben ihn erst vor kurzem besucht. Aber er ist eben nicht mehr der starke Mann, der sich in alles einmischt. Der Mann, ohne den nichts läuft auf der größten karibischen Insel. Und vor allem: Er wird nie wieder öffentliche Reden von fünf, sechs oder gar sieben Stunden halten. Ohne solche Reden aber ist Castro halb tot.
Marathon-Vorträge als sportliche Höchstleistungen
Im kühl denkenden Mitteleuropa wurden seine Marathon-Vorträge eher als kuriose sportliche Höchstleistungen bewertet. Rein rhetorisch waren sie oft nicht einmal gut. Castro begann seine Reden meist mit unsicherer, leiser Stimme, tastete sich vorsichtig voran und wich wieder zurück, so dass die Zuhörer den Eindruck hatten, er wisse selbst nicht so recht, was sein Thema sei. Und selbst wenn er es endlich gefunden hatte, verlor er sich immer wieder in unzähligen Anekdoten und Beispielen und Zahlen und nur das Ende der Rede war gewiss: "Socialismo o muerte!" - Sozialismus oder der Tod!
Die Kubaner hörten ihm zu bis zum Schluss und das nicht, weil sie dazu gezwungen worden wären. Wenn eine dieser Reden im Fernsehen übertragen wurde, war es still auf den Straßen von Havanna. Man hörte nur die eine, seine Stimme tausendfach aus den geöffneten Fenstern. Angela Merkel würden die Deutschen so gebannt nicht einmal eine halbe Stunde zuhören.
Das hat nichts mit den rhetorischen Fähigkeiten der Kanzlerin zu tun, sondern mit der Macht des gesprochenen Wortes. Und die ist in Lateinamerika viel, viel größer als in Europa. Denn in Lateinamerika waren die meisten Menschen bis vor wenigen Jahrzehnten noch Analphabeten. Wissen wurde nicht in Schriftform vom einen zum anderen gegeben, es wurde erzählt. Und bis heute gilt: Wer viel zu erzählen hat, weiß auch viel, und das verdient Bewunderung. Reden können in Lateinamerika ein ganzes Volk betören.
Oft hatte er kein Manuskript dabei
Castros Reden hörten sich an wie einfach so aus einem reichen Wissensschatz dahergeplaudert. Oft hatte er kein Manuskript dabei, und wenn er eines hatte, wich er davon ab. Die meisten Kubaner wissen bis heute nicht, dass hinter diesem Wortschwall harte, oft Monate lange Vorbereitungsarbeit steckte. Einer seiner ehemaligen Minister, der heute weit über achtzig Jahre alt ist, hat das nach ein paar Gläsern Rum spät in der Nacht erzählt. Er war in den sechziger Jahren mit Castro quer über die Insel gereist, hatte Bäuerchen getroffen und Fabrikarbeiter, Hausfrauen und Lehrer. Von jedem ließ sich der Staatschef wie ein Vater die Sorgen erzählen. Er konnte lange und geduldig zuhören. Doch danach löcherte er jeden Gesprächspartner mit den immer selben Fragen.
Er wollte wissen, wie sie über Enteignungen dachten, über landwirtschaftliche Kooperativen oder freie Bauernmärkte. Er rückte ihnen regelrecht auf die Pelle, fasste sie beim Hemd, drehte an den Knöpfen ihrer Jacke. Er ließ sie erst wieder los, wenn er sie ausgequetscht hatte und wirklich nichts mehr zu erfahren war. Seine Mitarbeiter waren von diesem sich endlos wiederholenden Ritual schon nach wenigen Tagen genervt. Fidel war das egal. Er machte sich, kaum dass er wieder im Auto saß, viele Seiten Notizen. Und ein paar Wochen später hielt er eine Stunden lange Rede zu Problemen der Landwirtschaft, gespickt mit Beispielen, Zahlen und Anekdoten.
Dieser Mann wusste einfach alles
Die Kubaner waren von solchen Reden beeindruckt: Dieser Mann wusste einfach alles. Auch über sie. Das fordert Respekt und macht gleichzeitig ein bisschen Angst. Seine Reden hoben Fidel Castro vor den Augen der Kubaner hinauf in den Himmel. Von dort schaute er dann herunter, manchmal gütig und manchmal sehr zornig.
Diesen Fidel Castro wird es nie wieder geben. Er ist 81 und gezeichnet von schwerer Krankheit. Er wird nie mehr die Kraft haben, um die Kubaner am Hemd zu packen und auszuquetschen und dann ihre Geschichten in großen Reden zu erzählen. Er herrscht nicht mehr über das gesprochene Wort. Er ist verschwunden und geistert nur noch als Zombie mit Kommentaren durch die parteigesteuerte Presse.