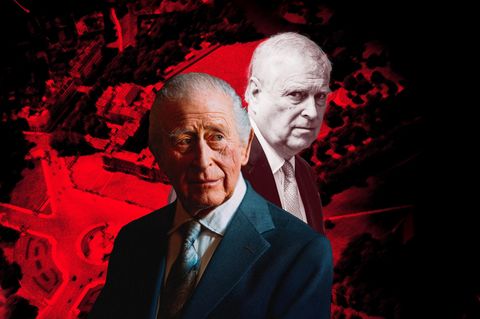Die Zeitung haben sie nicht totgekriegt. Am zehnten Jahrestag des Anschlags erscheint Frankreichs Satireblatt "Charlie Hebdo" mit einer Sonderausgabe: "Unzerstörbar!" lautet die Titelzeile, darunter die Zeichnung eines sichtlich gut gelaunten Lesers, der mit gespreizten Beinen auf der Mündung eines Maschinengewehrs sitzt. Auf rotgezacktem Hintergrund wird außerdem das Ergebnis einer Meinungsumfrage angepriesen: "76 Prozent der Franzosen befürworten die Freiheit der Karikatur."
Eine erfreuliche Zahl, betont Gérard Biard, der aktuelle Chefredakteur des Magazins, im Vorwort zur Ausgabe. Im Gegensatz zur gefühlten Lage zeige sie nämlich: Die Zustimmung für Spott à la "Charlie" ist in den vergangenen Jahren gestiegen – auch wenn er sich gegen Religionen und Dogmen richtet. Biard wertet das als gute Nachricht: Die Mehrheit der Franzosen sei weit davon entfernt, auf ihr historisches Recht verzichten zu wollen, Macht und Mächtige genüsslich zu verhöhnen.
"Mehrheit" ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Wort – denn über kaum ein Thema wird in Frankreich so heftig debattiert, wie über die Zersplitterung der Gesellschaft. "Je suis Charlie", hieß es damals solidarisch. Heute aber fragt man sich eher: Wer ist heute noch Charlie? Und liefert die düstere Antwort gleich mit: Die Solidarität, die 2015 nach dem brutalen Anschlag auf die Redaktion das Land einte – die scheint dieser Tage perdu.
"Charlie Hebdo" heißt auch: die Freiheit, "Gott scheiße zu finden"
Bereits seit 2006 hatte "Charlie" immer wieder Mohammed-Karikaturen gedruckt: "Es ist hart, von Idioten geliebt zu werden", klagte der Prophet da auf einer Titelseite. Über ihm die Zeile: "Mohamed von Fundamentalisten überfordert". Trotz der Präzisierung fühlten sich schon damals muslimische Vereine von der kleinen Zeitung angegriffen. Und nicht nur sie: Auch Teile der Linken warfen "Charlie" wegen seiner kompromisslos ketzerischen Haltung Islamfeindlichkeit vor. Es war der Beginn eines Streits, der bis heute andauert.
Nach dem ersten Ärger wurde das Satireblatt noch häufig von Islam-Verbänden verklagt. Dass ausgerechnet Marine Le Pen irgendwann das Magazin verteidigte, machte die Lage nicht besser. Doch "Charlie", der weltliche und humanistische Trotzkopf, pestete vor allem gegen den aufkeimenden Kulturrelativismus, den er in Kreisen der Linken witterte: Kritik an der Religion sei legitim, verteidigte sich die Redaktion. Es gehe um die Freiheit, "Gott scheiße zu finden". Diese müsse auch für den Islam gelten. Das Gerede von "Islamophobie" und religiöser Diskriminierung sei verlogen, weil es das wahre Problem verschweige – Rassismus gegen Muslime und Araber. Die Veröffentlichung seines Pamphlets "Brief an die Heuchler, und wie sie den Rassisten in die Hände spielen" erlebte der damalige "Charlie Hebdo"-Chefredakteur Stéphane Charbonnier nicht mehr.
Am Vormittag des 7. Januar 2015 stürmten zwei bewaffnete Brüder das Büro der Zeitung. Sie töteten zwölf Menschen. Aus Rache, wie sie sagten, für den Propheten. Am 8. Januar 2015 erschoss einer ihrer Kumpels eine Polizistin. Am 9. Januar ermordete derselbe Täter in einem koscheren Supermarkt vier jüdische Männer. Und "Charlie Hebdo", das bockige Blatt mit seinem oft vulgären Pups-Humor, wurde weltweit zur Galionsfigur für Meinungsfreiheit. Auf der Titelseite der ersten Ausgabe nach dem Anschlag weinte Mohammed: "Alles ist vergeben."
Zehn Jahre später ist "Charlie" noch immer das Blatt, das mit derbem Spott aneckt. Als sich im Iran die Frauen aus Protest gegen die religiöse Diktatur das Kopftuch herunterrissen, karikierte das Magazin die Situation in Frankreich, wo gerade mal wieder für das Recht auf die Verschleierung von Schulmädchen demonstriert wurde. Auch das Vergewaltigungsopfer Gisèle Pelicot zierte kürzlich den Titel. Unter der Rubrik "Mann des Jahres" sagte sie: "Es waren 51". Vor allem aber ist "Charlie" seinem aufklärerischen Geist treu geblieben: Was zählt, sind Gleichheit, Freiheit und Laizität – alles andere ist dummes Zeug.
Für Frankreich waren die tödlichen Schüsse im Januar 2015 der alptraumhafte Beginn eines Jahres, das schrecklich enden sollte: Am 13. November folgten die Anschläge auf das Bataclan und andere Ziele in der Pariser Innenstadt. Für Heilung oder Erholung blieb auch danach kaum Zeit. 2016 steuerte in Nizza ein Islamist einen Lkw in eine feiernde Menschenmenge. Im Oktober 2020 wurde der Lehrer Samuel Paty enthauptet – der islamistische Terror hat Wunden hinterlassen. Angst. Und tiefe Gräben.
"Charlie" wird auch von der extremen Rechten instrumentalisiert
Denn auch das hat sich in den vergangenen zehn Jahren verändert: Die extreme Rechte, präsenter als je zuvor, instrumentalisiert die von "Charlie" und seinen Anhängern propagierte Meinungsfreiheit längst für ihre Tiraden gegen Migranten und Minderheiten. Währenddessen gilt es in Teilen des linksextremen Spektrums inzwischen als salonfähig, die antisemitische Terrororganisation Hamas als islamische Widerstandsbewegung zu glorifizieren. Zwei Pole, die lautstark den Alltag und die Diskussion bestimmen wollen.
Der zehnjährige Jahrestag des Anschlags auf die Redaktion von "Charlie Hebdo" erinnert an die Opfer. An brillante Menschen, die von hasserfüllten Fanatikern ermordet wurden. Er erinnert aber auch an das, was auf dem Spiel steht. Die Werte der Republik, die offene und soziale Gesellschaft, können nur gemeinsam verteidigt werden. Freiheit, Gleichheit, Laizität – der Geist von "Charlie" reicht weit über seine Karikaturen hinaus. Seine unerschrockene Gradlinigkeit kann ein hervorragender Kompass sein in diesen komplizierten Zeiten. Und er hat immer noch viel zu tun.