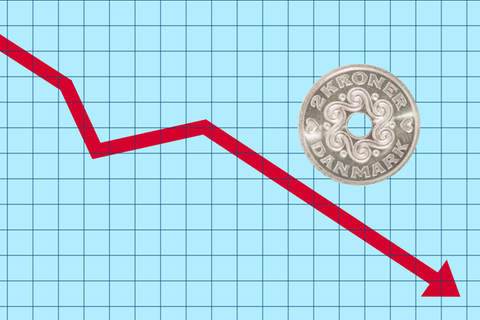Der Euro ist weiter im Aufwind - erstmals seit Herbst 2011 hat die Gemeinschaftswährung am Freitag die Marke von 1,37 US-Dollar überwunden. Experten und Politiker betrachten den Kursauftrieb allerdings skeptisch. Eine starke Währung mache Exporte teuer und bedrohe damit die wirtschaftliche Erholung in den Euro-Krisenländern, so die Warnungen. Doch der Euro könnte erst am Anfang eines Aufwärtstrends stehen. Denn während die Schuldenkrise sich zu beruhigen scheint, spült die ungebremste Geldflut großer Notenbanken internationales Finanzkapital an. Droht die Eurozone, Opfer eines "Währungskriegs" zu werden, bei dem die großen Volkswirtschaften sich darin übertrumpfen, ihre Wechselkurse nach unten zu manipulieren? Fragen und Antworten:
Wenn der Wechselkurs steigt, verteuern sich die Waren und Dienstleistungen der heimischen Unternehmen im Ausland. Im Zeitalter der Globalisierung mit wachsendem Konkurrenzkampf um Märkte kann das ein großer Nachteil sein. Dazu kommt, dass viele Industriestaaten mit hohen Schulden kämpfen. Die Sparanstrengungen - zum Beispiel Steuererhöhungen oder Einschnitte im Sozialwesen - dämpfen die Nachfrage im eigenen Land. Um die Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen, kommt es deshalb immer stärker auf den Absatz in den wenigen Regionen der Welt an, die noch attraktive Perspektiven bieten. "Die Versuchung, durch eine Abwertung der eigenen Währung neue Wachstumsimpulse für die eigene Volkswirtschaft zu erzeugen, ist in dem aktuellen Umfeld groß", sagt Edgar Walk, Chefvolkswirt beim Bankhaus Metzler.
Welche Rolle spielen die Notenbanken?
Weltweit stemmen sich Zentralbanken gegen die Krise, indem sie massiv Liquidität in den Finanzsektor pumpen. Während dies tendenziell den Wert der eigenen Währung verwässert, treibt die Geldflut die Wechselkurse in anderen Regionen in die Höhe - zum Leidwesen der dortigen Exporteure. Bei den bisherigen Krisenmaßnahmen ging es zwar in erster Linie darum, akute Brandherde im Bankensektor und an den Anleihemärkten zu löschen. Auswirkungen auf die Wechselkurse galten bislang eher als Nebeneffekt dieser Feuerwehreinsätze. Doch seit die neue japanische Regierung massiv Druck auf die ihre Zentralbank ausübt, die Geldschleusen noch weiter zu öffnen, um das chronisch lahme Wachstum anzuschieben und auch den starken Yen zu bremsen, weht ein anderer Wind. Das Schlagwort vom "Währungskrieg" macht die Runde, Top-Entscheider der Eurozone verfolgen die Entwicklungen in Japan mit Argwohn. Bundesbankchef Jens Weidmann warnte bereits vor einer "Politisierung der Wechselkurse".
Wie groß ist die Gefahr für die Eurozone?
"Das aktuelle Wechselkursniveau des Euro ist sicherlich - noch - unproblematisch, das Tempo der Aufwärtsbewegung dagegen schon eher", sagt Metzler-Chefökonom Walk. Sollten die anderen großen Notenbanken weiter auf eine extrem lockere Politik des billigen Geldes setzen, würde die Europäische Zentralbank (EZB) schnell ins Hintertreffen geraten. Zu diesem Schluss kommt auch eine Studie der Bank of America. Während alle anderen versuchen könnten, ihre Wechselkurse zu drücken, um die Wirtschaft zu stützen, sei die EZB allein ihrem Inflationsziel verpflichtet. "Das Endergebnis wäre eine schwächere Euro-Wirtschaft, die eventuell die Unabhängigkeit der EZB gefährden könnte." EZB-Präsident Mario Draghi gibt sich bislang betont gelassen und verweist auf ein Abkommen der G20, das Wechselkursmanipulationen verbietet. Am 15. Februar findet das nächste Treffen der Finanzminister der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer statt, auch um den G20-Gipfel im September in St. Petersburg vorzubereiten - das Thema "Währungskrieg" drängt sich auf.